Kapitel 22
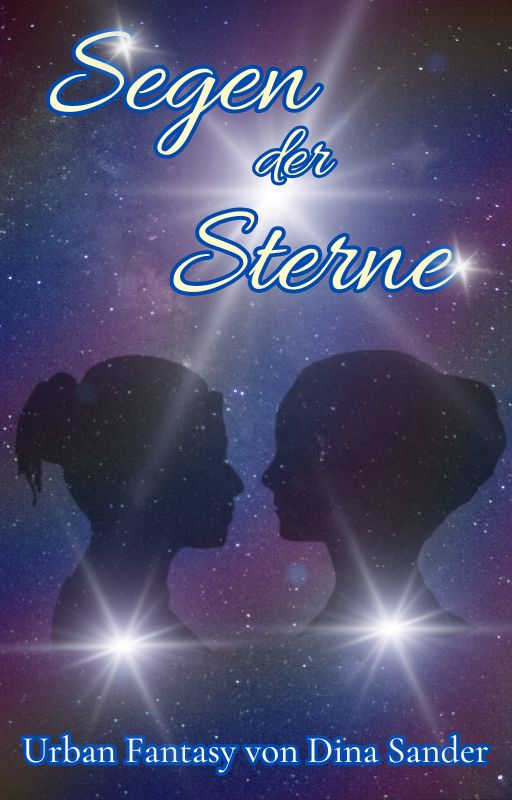
Am Mittwochmorgen betrat ich das Archiv mit einem Lächeln auf den Lippen. In meinen Händen hielt ich zwei Becher mit dampfendem Tee – marokkanische Minze für Yasmin und mich. Ein kleines Ritual, das wir uns in den letzten Wochen angewöhnt hatten.
Doch als ich die Tür zu unserem Arbeitsplatz erreichte, war alles still – so wie gestern, als sie ihren Termin gehabt hatte. Da war kein Rascheln von Papier, kein gedämpftes Summen, wenn sie für das Ungeborene sang. Nur das leise Brummen der Klimaanlage.
Ich trat an den Tisch neben den Spinden und stellte beide Becher ab. Nachdenklich zog ich meine Jacke aus und packte sie zusammen mit dem Rucksack in meinen Spind. Dann ging ich zu einem der Computer und fuhr ihn hoch.
Plötzlich hörte ich Schritte. Ein Lächeln stahl sich in meine Mundwinkel, aber es erlosch fast sofort wieder. Das war nicht Yasmin. Sie trat nicht so kräftig auf, und sie ging auch nicht mehr so schnell. Ich behielt recht, es war die stellvertretende Abteilungsleiterin.
„Guten Morgen, Frau Sommer, schön, dass ich Sie hier antreffe.“ Sie lächelte und legte einen dicken Aktenstapel neben mich. „Eigentlich sollte Frau Derya diese Akten durchsehen, aber sie hat sich für heute krankgemeldet. Meinen Sie, dass Sie das schon allein schaffen?“
Ich zuckte kurz zusammen. Was meinte sie mit ihrer Frage? Wollte sie mir damit unterschwellig andeuten, dass ich nicht gut genug für das Archiv war? Meine Atmung beschleunigte sich. Ich wollte nicht schon wieder entlassen werden, es gefiel mir hier viel zu gut!
„Ich … äh … Ich schaffe das. Frau Derya hat mich gut eingearbeitet.“ Meine Stimme klang zuversichtlicher, als ich mich fühlte. Aber Frau Peters schien es gar nicht zu bemerken.
„Wunderbar, das freut mich zu hören.“
„Was ist denn mit Frau Derya“, wagte ich nachzufragen. „Ist … Ist etwas passiert?“
Frau Peters schüttelte den Kopf. „Ich denke nicht, davon hat sie nichts gesagt. Sie hat sich telefonisch abgemeldet, sie fühle sich nicht gut. Aber so ist das, wenn man hochschwanger ist.“
„Haben Sie vielleicht … eine Nummer? Oder ihre Adresse? Ich würde sie gern besuchen.“
Frau Peters zuckte bedauernd mit den Schultern. „Ich verstehe Ihr Anliegen, Frau Sommer, wirklich. Aber das darf ich aus Datenschutzgründen leider nicht weitergeben.“
Ich nickte. „Ja, ich verstehe. Dann mache ich mich mal an die Arbeit.“
„Viel Erfolg – und noch einen schönen Tag, Frau Sommer.“
„Danke, Ihnen auch, Frau Peters.“
Ich sah ihr nicht nach, sondern griff direkt zu dem Aktenstapel. Für einen Moment schloss ich die Augen, und das Bild vom Greif tauchte vor mir auf. Sofort flutete mich Wärme und Ruhe. Ich betete zu den Sternen, dass es Yasmin gut ging und sie bald wieder käme.
Am Donnerstagmorgen war Yasmin wieder da. Sie saß bereits vor einem Computer und tippte konzentriert, als ich den Archivraum betrat. Sie drehte nicht einmal den Kopf, was mich überraschte und verunsicherte.
„Guten Morgen“, sagte ich vorsichtig.
Sie wandte den Blick nicht vom Monitor ab und nickte kaum merklich. „Morgen.“
Mehr nicht.
Kein Lächeln. Keine Erklärung für gestern. Und nichts über den Besuch bei der Frauenärztin.
Langsam stellte ich die Tasse mit ihrem Lieblingstee neben sie. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte: „Und? Wie geht es dir? Und dem Baby?“
„Gut.“
Ich schluckte. So kurz angebunden hatte sie mir noch nie geantwortet. Eigentlich waren einsilbige Antworten mein Ding. Aber was sollte ich tun? Vielleicht war genau jetzt die richtige Zeit, um einfach da zu sein. Einfach neben ihr zu sein. Ohne Fragen.
In der ersten Pause blieb sie unten. Ich blieb bei ihr. In der zweiten Pause wieder. Ich hielt ihr meine Brotdose hin, in der ich mein gesundes Frühstück transportierte: klein geschnittene Karotten und Äpfel. Doch sie lehnte kopfschüttelnd ab.
„Yasmin“, mahnte ich, „du musst etwas essen und trinken. Sonst schädigst du nicht nur dich selbst, sondern auch das Baby.“ Ich wusste nicht, woher ich den Mut nahm, so zu ihr zu sprechen, aber ich spürte, dass es wichtig war. Sie zuckte auf jeden Fall zusammen und griff in die Dose. Ich ließ sie offen neben ihr stehen und verließ das Archiv. Im Personalraum kochte ich uns Tee auf, den ich nach unten brachte. Dieses Mal trank sie ihn auch.
Immer stärker erwachte in mir das Bedürfnis, sie zu berühren, meine Hand auf ihren Arm zu legen, ihr irgendwie zu zeigen, dass ich mich sorgte. Aber ich wagte es nicht. Sie wirkte so ablehnend. Ich hatte Angst, ihr zu nahe zu treten.
„Sollen … Sollen wir zusammen mit dem Bus heimfahren?“, schlug ich kurz vor Feierabend vor. Ich hoffte, auf diese Weise ihre Adresse herausfinden zu können. Doch Yasmin schüttelte den Kopf. Ihre Antwort kam fast geflüstert.
„Ahmed holt mich ab.“
„W-wir … äh … k-könnten Nummern austauschen“, stammelte ich. Bevor sie Nein sagen konnte, schob ich ein kleines Stück Papier zu ihr hin, auf dem meine Adresse und meine Nummer standen. Sie griff danach, drehte es zwischen ihren Fingern und steckte es schließlich umständlich in die Sporthose unter ihrem weiten Gewand.
Ich atmete erleichtert auf. Nun hatte ich zwar immer noch nicht ihre Nummer, aber sie konnte mich jederzeit anrufen. Das gab mir ein besseres Gefühl.
Am Freitagmorgen nahm ich einen früheren Bus. Ich wollte unbedingt vor Yasmin bei der Zentralbibliothek sein. Sie hatte am Tag zuvor abgelehnt, dass ich sie nach draußen begleitete, wo Ahmed sie abholen wollte. Darum hoffte ich, sie heute Morgen zu sehen, wenn er sie brachte. Ich wollte unbedingt den Mann kennenlernen, der meine Freundin so verängstigte.
Natürlich drückte ich mich nicht draußen herum. Ich betrat das Gebäude, fuhr erst einmal ins Archiv, um zu prüfen, ob sie nicht doch schon da war. Sie war es nicht. Also fuhr ich rasch in den ersten Stock und stellte mich an eines der bodentiefen Fenster und schaute auf den Platz vor dem Personaleingang hinunter. Mich überkam das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, dabei stimmte das gar nicht. Als Bibliotheksangestellte durfte ich mich hier oben aufhalten.
Und als Freundin von Yasmin durfte ich mich um sie sorgen.
Ich stand einfach nur da. Wartete und starrte hinaus. Tauben trippelten umher, frühe Passanten hasteten über den Platz, einige hielten auf Geschäfte zu, andere kamen aus Gebäuden und waren wohl auf dem Weg zu ihrer Arbeit. Am Rande des Platzes hielt ein Wagen, der meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Er war dunkelrot, mit getönten Scheiben. Ich konnte sogar aus dieser Entfernung erkennen, dass er schon einiges erlebt hatte. Der Kotflügel war verbeult, in der Seitentür war eine Delle.
Obwohl mein Gefühl es geahnt hatte, war ich dennoch überrascht, als sich die Tür öffnete und Yasmin ausstieg. Leider blieb der Fahrer sitzen. Yasmin blickte noch einmal ins Auto hinein, danach ging sie einen Schritt zurück, schlug die Tür zu, hob kurz die Hand und drehte sich um. Das Auto blieb so lange dort stehen, bis sie im Personaleingang verschwunden war. Dann erst fuhr es los.
Jetzt war ich nicht viel klüger als vorher – oder vielleicht doch? Ich hatte gedacht, dass Ahmed ein teures Auto fahren würde. Immerhin arbeiteten sie beide und hatten noch keine Kinder, für die sie Geld ausgeben mussten. Aber dann erinnerte ich mich an Yasmins Worte, dass hier in Deutschland alles viel teurer war und sie deshalb arbeiten musste.
Als ich das Archiv betrat, saß sie bereits an ihrem Platz. Schweigend stellte ich ihr den Tee wie jeden Morgen hin. Dann zog ich meine Jacke aus und hängte sie in meinen Spind. Ich stellte meine Tasche dazu und schloss den Rollcontainer auf, der gestern Abend angeliefert worden war. Heute hieß es Aussortieren. Ich ergriff die erste Kiste und trug sie an den Tisch, stellte sie zwischen unsere Arbeitsplätze ab. Dann setzte ich mich und startete den PC.
Yasmin hatte bisher kein Wort geredet. Sie saß einfach da, noch mit ihrem Mantel bekleidet und der Tasche vor sich auf dem Tisch. Es war eine bedrückende Stimmung, die ich kaum zu durchbrechen wagte.
„Guten Morgen“, sagte ich leise.
Sie nickte und blieb stumm. Mein Herz zog sich schmerzerfüllt zusammen. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun könnte. Sie war völlig anders. Mein Blick huschte zu ihrem Bauch. Die Wölbung war noch da. Eine vorzeitige Geburt konnte nicht der Grund sein für ihr verändertes Verhalten sein, das Baby war noch da drin.
Irgendwann stand Yasmin auf, zog den Mantel aus, packte ihre Tasche weg und machte sich an die Arbeit. Stunde um Stunde arbeiteten wir schweigend nebeneinander. Ich beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Schob ihr meine Brotdose mit Obst hin, füllte ihr Getränk aus meiner Thermoskanne auf. Einmal fiel ihr ein Ordner aus der Hand. Sie bückte sich nicht sofort, sondern verharrte, als müsste sie erst Kraft sammeln. Ich hob ihn für sie auf, reichte ihn ihr. Unsere Hände berührten sich – und sie zuckte zusammen.
In dem Moment zerbrach etwas in mir. Ich konnte nicht mehr. Wann hatte sich unsere zarte Freundschaft in diese offenkundige Ablehnung verändert?
„Yasmin, was ist los?“ Ich drehte mich zu ihr. „Ich mache mir Sorgen.“
Erst starrte sie nur vor sich hin. Ihre Finger hielten krampfhaft ein Buch fest. Dann brach es plötzlich aus ihr heraus: „Es ist ein Mädchen!“
Ich unterdrückte den Impuls, sie zu beglückwünschen. Denn sie wirkte nicht so, als würde sie sich darüber freuen. Ganz im Gegenteil. Ihr sonst so schönes braunes Gesicht sah ungesund und blass aus. Tränen liefen ihr über die Wangen, und ich wusste, dieses Mal waren es tatsächlich Tränen vor Traurigkeit.
„Er wollte einen Jungen“, schluchzte Yasmin. „Er hat allen gesagt, ich würde seinen Sohn gebären. Und dann … und dann …“ Sie wischte sich hastig über die Wangen, doch die Tränenflut machte sie sofort wieder nass. „Bei der Frauenärztin blieb er noch ruhig“, sprach sie weiter. „Aber ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit. Denn … Er hat keine Bilder vom Ultraschall verschickt.“
Ich begriff nicht, was mir Yasmin damit sagen wollte. Doch ich stellte keine Fragen, ich ließ sie reden. Ich war froh, dass sie endlich sprach.
„Zu Hause hat er mich …“ Sie wischte wieder über ihre Wangen. Ihr Schluchzen wurde lauter. Langsam schob sie die Ärmel ihres Gewandes hoch. Ich schnappte nach Luft. Ihre Arme waren voller Blutergüsse. Bestürzt sah ich ihr in die Augen, doch sie wich meinem Blick aus. Stattdessen zog sie das Gewand hoch, bis ihr Pullover sichtbar wurde. Ein kalter Schauer fuhr mir über den Rücken, und mein Herz blieb für einen Moment stehen. Ich ahnte, was sie mir zeigen wollte.
Als ich die Misshandlung sah, schossen mir die Tränen in die Augen. Spontan streckte ich meine Hände aus, legte sie ganz vorsichtig und sehr sanft auf den Bauch. Ich wünschte mir so sehr, dass das Baby sich bewegte und mir zeigte, dass alles in Ordnung war. Doch es bewegte sich nicht.
„Er hat geschrien. Mich gestoßen. Er sagte, er braucht kein Mädchen. Dass er es mir aus dem Leib prügeln wird, wenn ich es nicht wegmachen lasse. Er sagte, dass Mädchen Schwäche bedeuten und ich ihm Schande bringe.“
Ich sah zu ihr hoch, während ich die Hände auf ihrem Bauch ließ. Aber sie sah mich nicht an. Ihr Blick war zur Seite gerichtet.
„Ich habe Angst, Verena“, flüsterte sie. „Ich weiß nicht, was ich tun soll.“
„Können dir deine Schwiegermutter und deine Schwägerin nicht helfen?“
„Nein, meine Schwiegermutter hat mir angedroht, mir alle Fingernägel einzeln herauszureißen, weil ich ihr nicht den versprochenen Enkel schenke. Und meine Schwägerin … Sie ist froh, dass sie schon einen Sohn geboren hat, sie wird mir auch nicht helfen.“
„Es gibt Frauenhäuser. Ich rufe bei der Polizei an, die bringen dich in eins. Da bist du sicher.“
Yasmin ließ die Schultern hängen. „Keine Polizei. Und kein Frauenhaus. Sie haben doch recht, es ist nur ein Mädchen. Ich … Ich schäme mich so.“
Bestürzt senkte ich meinen Kopf. Sie war so sehr mit ihrer Kultur verbunden, dass sie es nicht wagte, offen für ihr Baby einzutreten. „Du musst dich nicht schämen, Yasmin. Auch ein Mädchen ist ein Mensch, ein kleines Wunder. Und dein Mädchen verdient es ebenso wie ein Junge, geliebt zu werden.“
Vorsichtig streichelte ich ihren Bauch, versuchte, nicht auf die blauen Flecke zu achten. Versuchte, nicht daran zu denken, dass Ahmed meine geliebte Yasmin seit Dienstag verprügelte – und ich hatte ihr nicht helfen können.
„Yasmin, du kannst nicht zu ihm zurück.“
„Aber wo soll ich denn hin?“
„Komm mit zu mir“, sagte ich. „Für heute Nacht. Oder für länger. Wie du willst. Mein Bett ist bequem, und ich habe ein Sofa. Mein Kühlschrank ist voll. Und wenn du besondere Wünsche hast, dann kann ich es holen.“
Sie sah mich an – voller Zweifel. Die Trauer in ihren cremig braunen Augen schmerzte mich.
„Komm mit zu mir, bitte. Ich schweige, wenn du schweigen willst. Ich rede, wenn du reden willst. Ich bin einfach da.“
„Du würdest das wirklich tun?“ Sie sah mich lange an, ihre Unterlippe bebte. Ich nickte stumm. Zögernd beugte sie sich vor, bis ihre Stirn sacht meine berührte. Einen Moment lang blieben wir einfach so. Dann spürte ich ihre warmen Hände, wie sie sich auf meine legten. Hoffnung durchströmte mich.
Alles würde gut werden – es musste so sein!



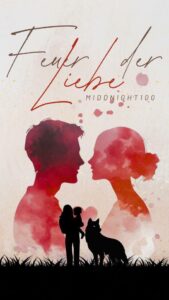






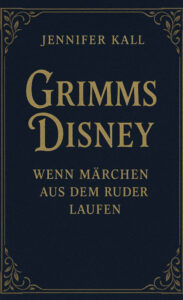















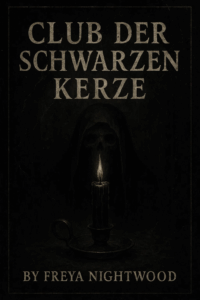



Kommentare