SdS – Kapitel 7
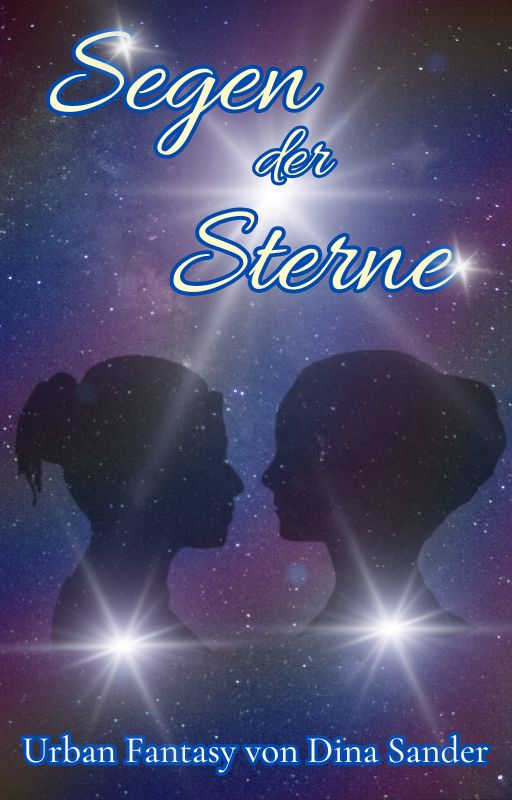
„Ich kann das nicht mehr, Mama.“ Stockend brachte ich die Worte hervor, während ich auf der geblümten Couch im Wohnzimmer meiner Eltern saß. Mein Blick war auf die dampfende Tasse Tee in meinen Händen gerichtet, aber ich nahm das Aroma der Kamillenblüte kaum wahr. Beruhigung half mir jetzt auch nicht weiter.
Meine Mutter setzte sich neben mich, ihre Stirn in Sorgenfalten gelegt. „Was genau ist denn passiert, Liebes?“ Sie legte ihre Hand auf meinen Oberschenkel und tätschelte ihn sanft.
Ich seufzte ganz tief, als ob ich damit den Schmerz einer ganzen Welt hinaustreiben könnte. „Die ersten beiden Seminartage waren eine Katastrophe“, brach es schließlich aus mir heraus. „Aber heute war nur noch …“ Ich konnte nicht weitersprechen, die Erinnerung war fast genauso schrecklich, wie es die Situation gewesen war. Tränen tropften meine Wangen hinunter, auf meine Hände und vereinzelt in den Tee.
„Ach, Verena.“ Meine Mutter nahm mir fürsorglich die Tasse ab, stellte sie auf den Couchtisch und zog mich in eine Umarmung. Schluchzend schmiegte ich mich an sie und genoss es, wie sie mir über den Kopf streichelte und vorsichtig auf den Rücken klopfte. Sie sagte kein Wort, ließ mich einfach weinen und schluchzen.
Als ich mich etwas gefangen hatte und von ihr löste, reichte sie mir ein Taschentuch. Mit einem schiefen Lächeln nahm ich es entgegen. Sie nickte aufmunternd und strich mir über die Wange. „Du weißt, dass der Papa und ich dich lieben. Wir helfen dir bei allem, Kind.“
„Danke, Mama“, brachte ich schniefend hervor. Ich wischte mir die Tränen fort und putzte die Nase. Dann holte ich tief Luft. Mein Mantra huschte durch meinen Kopf. Vielleicht sollte ich nach einem stärkeren Spruch suchen.
„Weißt du, Mama, ich möchte ja gern alles so toll hinbekommen wie die anderen. Aber ich fühle mich in größeren Gruppen einfach nicht wohl. Und wenn es dann lauter fremde Menschen sind, ist das …“ Wieder brach ich ab und schluchzte auf.
„Dann ist das Horror für dich“, sprach meine Mutter für mich zu Ende. „Ich weiß, dein Vater hat auch das Problem. Und sieh mich an“, sie hob entschuldigend die Schultern, „ich bin auch nicht der ausgehfreudige Mensch, der mit jedem warm wird. Das hast du von uns beiden mit in die Wiege gelegt bekommen.“
„Aber Lisa kann das doch auch alles, und sie ist auch eure Tochter.“ Meine Stimme klang ein wenig anklagend.
„Ja, die Lisa, sie kommt eher nach der mütterlichen Seite von deinem Papa. Die feiern ganz gern und sprechen wildfremde Menschen an. Aber meine Eltern sind beide ruhig, und die Familie deines Großvaters gehört auch zu den Stillen. Das sind mehr Denker als Redner.“ Sie strich mir über die Wange und lächelte aufmunternd. „Es gibt nun einmal Menschen, die fühlen sich allein in einem Büro wohl, während andere hinausgehen und vor den Menschenmassen reden müssen, um richtig aufzublühen.“
„Herr Lehmann sieht das etwas anders“, murmelte ich und verzog das Gesicht.
„Wie sieht er es denn?“
Bei der Erinnerung trieb es mir wieder Tränen in die Augen, doch dieses Mal zwang ich mich, sie hinunterzuschlucken und alles zu erzählen.
„Ich habe bei allen Übungen versagt. Und als ich sagen sollte, für welchen Beruf ich mich nach diesen drei Tagen entschieden habe, konnte ich keinen nennen.“ Traurig blickte ich auf meine Hände, die sich von ganz allein verknotet hatten. Ich machte das schon aus Gewohnheit.
„Das verstehe ich nicht“, meinte meine Mutter und schüttelte verwirrt den Kopf. „Du hast uns doch erzählt, dass du im Büro arbeiten möchtest. Oder gern auch im Archiv, Akten sortieren, Ablage machen. Obwohl das heute wohl alles eher mit dem Computer gemacht wird.“
„Ja, aber das konnte ich Herrn Lehmann doch nicht sagen.“
„Warum nicht?“
„Na, weil es kein Beruf ist, im Archiv Akten zu sortieren oder Ablage zu machen. Das ist irgendwie Bestandteil des Berufs Bürokauffrau oder so. Und dazu müsste ich telefonieren und frei mit anderen reden können. Vielleicht sogar Verkaufsgespräche am Telefon führen.“
Meine Mutter nickte verstehend. „Hm, ja, da hast du wohl recht. Aber der Papa hat gesagt, dass Archivarin ein Beruf ist, nur brauchst du dafür Abitur oder Fachhochschulreife. Das scheint ein Studium zu sein.“
„Ich habe keine Fachhochschulreife“, erklärte ich. „Außerdem meine ich mit ‚im Archiv arbeiten‘ etwas anderes, als eine Archivarin zu sein. Ich möchte einen Job, bei dem ich Aufgaben bekomme, die ich in Ruhe und allein abarbeiten kann. Wenn ich ein oder zwei Kollegen habe, ist das okay. Doch so ein Großraumbüro mit zehn oder fünfzehn Leuten würde mich krank machen.“
Wieder nickte meine Mutter verstehend. Da sie nichts sagte, sprach ich weiter.
„Auf jeden Fall hat Herr Lehmann nach meinen wiederholten Patzern zu mir gesagt … Er hat gesagt …“ Ich schluckte und knetete so heftig mit meinen Fingern, dass ich den Schmerz spüren konnte. „Ich solle ernsthaft darüber nachdenken, mir professionelle Unterstützung zu holen. Das will er auch meiner Arbeitsvermittlerin Frau Behrens mitteilen.“
„Wie bitte?“ Meine Mutter richtete sich kerzengerade auf und starrte mich mit offenem Mund an. „Wie bitte?“, sagte sie dann mit noch mehr Nachdruck und stemmte die Hände in die Seiten. „Was soll das denn heißen? Glaubt er etwa, mit dir stimmt etwas nicht, nur weil du sehr schüchtern bist?“ Meine Mutter war sichtlich empört. Das tat mir unglaublich gut.
„Ja, na ja, irgendwie schon, Mama. Aber … Er hat ja recht, oder? Ich kann keine Gespräche führen, kann nicht mit Fremden telefonieren. Ich krieg’s nicht hin.“
Meine Mutter nahm meine Hände. Sofort breitete sich in mir eine angenehme Wärme aus, und ich entspannte mich ein wenig. „Schatz, du brauchst vielleicht Hilfe, ja. Aber nicht, weil mit dir etwas nicht stimmt, sondern weil du einfach nie Glück hattest.“
„Glück? Also meine Angst hat doch nichts mit Glück zu tun. Eine Teilnehmerin hat mir gesagt, ein Psychiater könnte mir Medikamente verschreiben, die mich lockerer machen. Damit würde es mir sicher besser gehen.“
Meine Mutter sah mir direkt in die Augen, aber ich konnte ihrem Blick nicht standhalten. Ich senkte den Kopf und starrte einen Punkt auf dem Teppich an. Da war ein Fussel.
„So so, ein Medikament könnte dich lockerer machen. Und du kannst mir nicht in die Augen sehen, weil du total davon überzeugt bist.“ Sie holte tief Luft. „Ich sag dir jetzt mal was, Verena, bevor du solch einen gravierenden Schritt gehst, nimmst du dir eine kleine Auszeit. Du fährst dieses Wochenende zu deiner Schwester. Die Kinder lenken dich garantiert ab von allen trübseligen Gedanken.“
Ich hob den Kopf. „Lisa und ihre Chaosbande?“
Meine Mutter nickte bekräftigend. „Ja. Lisa, Matthias und ihre Chaosbande. Deiner Schwester tut das gut, wenn die Tante mal nach ihrem Neffen und ihrer Nichte sieht, und dir auch. Und vielleicht hilft dir ein Gespräch mit Lisa mehr als irgendein Bewerbungscoaching.“
Ich zuckte mit den Schultern. „Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee.“
„Na, wunderbar.“ Meine Mutter stand auf. „Dann gehst du jetzt packen, und ich informiere Lisa, dass du dich gleich auf den Weg machst.“
„Gleich?“
„Ja, natürlich. Wann denn sonst? Der Freitag ist fast vorüber. Wenn du später fährst, ist vom Wochenende doch nichts mehr übrig.“
„Okay, sicher hast du recht. Ich packe und fahre gleich los.“ Ich stand ebenfalls auf. „Aber ganz so schnell wird das nichts. Immerhin fährt hier nur einmal die Stunde ein Bus in Lisas Richtung ab.“
„Mach dir darum mal keine Gedanken. Ich wette, Matthias wird dich gern abholen, wenn er hört, dass du bei ihnen Babysitterin wirst.“
Ich rollte mit den Augen. Das war meinem Schwager tatsächlich zuzutrauen. Und dass er direkt zwei Kinokarten holte, um mit seiner Frau zu verschwinden und mich mit den Kindern allein zu lassen, traute ich ihm ebenfalls zu. Aber ein Abend mit den beiden Kleinen war auf jeden Fall amüsanter als ein Tag Bewerbungstraining.
Natürlich behielt meine Mutter recht. Matthias holte mich ab, kaum dass sie ihm erzählte, dass ich das Wochenende Babysitterin spielen wollte. Und auch ich behielt recht. Bevor er ins Auto stieg, um zu mir zu fahren, bestellte er Kinokarten, damit ich keine Möglichkeit für einen Rückzieher hatte.
So passte ich auf meine fünfjährige Nichte Emma und ihren dreijährigen Bruder Noah auf, die einen beide ganz schön auf Trab halten konnten. Und als sie nach einem langen Spieleabend endlich im Bett lagen, erzählte ich ihnen noch eine Gute-Nacht-Geschichte von einem mutigen Ritter, der sich durch dunkle Wälder kämpfte, um ein verzaubertes Einhorn zu retten, und die dann beste Freunde wurden. Noch ehe ich zu Ende erzählt hatte, waren Emma und Noah schon eingeschlafen.
Bald darauf kamen meine Schwester und mein Schwager entspannt und vergnügt von ihrem Kinoabend zurück. Wir saßen noch kurz zusammen, bevor sich Matthias zurückzog. Doch als ich mit Lisa allein war, bohrte sie so lange nach, bis ich ihr den wahren Grund für meinen Besuch erzählte.
„Und er hat wirklich gesagt, du solltest dir professionelle Hilfe holen?“, fragte sie fast ebenso empört wie unsere Mutter. „Was fällt dem den ein? Wie soll er dich denn bitteschön nach nur drei Seminartagen richtig einschätzen können?“
„Vielleicht hat er aber recht“, murmelte ich. „Wenn mir ein Psychiater etwas verschreiben kann, das mir die Angst nimmt, warum nicht?“
„Weißt du was? Ich rufe jetzt Ute an, das ist eine der Mütter, die ich im Kindergarten kennengelernt habe. Sie hat mir erzählt, dass ihre beste Freundin gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollte. Die hatte wirklich schlimme Ängste. Und dann war sie bei einer Heilpraktikerin. Die hat ihr geholfen. Ute schwärmt richtiggehend von der Frau.“
Bevor ich Einwände erheben konnte, auch wegen der späten Uhrzeit, hatte Lisa schon ihr Handy hervorgekramt und rief bei der Mutter an. Resignierend ließ ich meine Schultern hängen. Denn mir wurde bewusst, dass ich Bekannte nicht in mein Handy als Kontakt einspeicherte. Lisa war da viel offener.
Es dauerte gar nicht lang, da hatte meine Schwester die Kontaktdaten von der Heilpraktikerin Nicole Buchner. Glücklicherweise rief sie da nicht mehr an.
„So, wunderbar, da rufe ich gleich morgen früh an. Mal sehen, was dabei herauskommt.“ Lisa strahlte mich glücklich an. Dann nahm sie mich in die Arme. „Du, Rena, es wird alles gut, ganz bestimmt.“
Ich erwiderte ihre Umarmung und schloss für einen Moment die Augen. Ich wollte es glauben, ich wollte es so sehr!





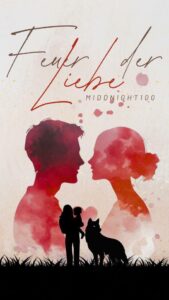







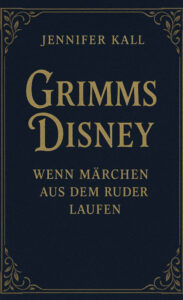




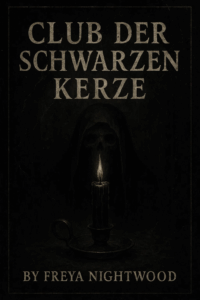




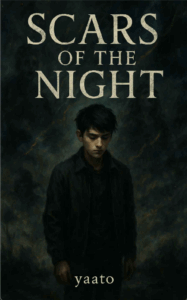








Kommentare