Lux mentis tuae detegatur!


Ich gehe durch das Portal zur Schule.
Schon von Weitem sehe ich Danny, der ungeduldig auf mich wartet. In seinen Händen hält er einen prächtigen Blumenstrauß – leuchtend, duftend, sorgfältig gebunden. Hinter ihm steht Martina, ihr Blick schwer zu deuten, irgendwo zwischen Neugier und stiller Eifersucht.
Danny lächelt unsicher, als ich näherkomme.
„Hey, Jemea“, sagt er, seine Stimme zittert leicht. „Martina hat mir erzählt, dass du Blumen magst… deshalb dachte ich, ich bringe dir welche mit. Gestern warst du so traurig.“
Seine Worte treffen mich mitten ins Herz.
Eine Welle von Wärme und Schuldgefühl durchströmt mich. Was ist nur los mit mir?
Ohne zu zögern trete ich einen Schritt näher, hebe vorsichtig sein Kinn, bis er mir in die Augen sehen muss. Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Dann berühre ich seine Lippen – sanft, flüchtig, aber voller Gefühl. Ein Kuss, zart wie ein Geheimnis.
Danny erstarrt. Seine Augen weiten sich, und sein Gesicht färbt sich rot wie die Rosen in seiner Hand. Doch dann lächelt er – zaghaft, ehrlich – und in diesem Lächeln liegt etwas, das mein Herz schneller schlagen lässt. Ich reiße mich los, verlegen über meine eigene Kühnheit, und nehme hastig die Blumen entgegen.
„Danke, Danny“, flüstere ich.
Dann wende ich mich an Martina, die uns beobachtet, und sage schnell:
„Wir sollten gehen – der Unterricht fängt gleich an.“
Martina hebt eine Augenbraue, sagt aber nichts.
Danny steht noch immer da, als müsste er das Geschehene erst begreifen. Schließlich nimmt Martina ihn sanft am Arm und zieht ihn mit sich.
Er gehört nicht in dieselbe Klasse wie wir Danny besucht die Grundstufe der magischen Künste, während Martina und ich im Fortgeschrittenenkurs „Manipulation durch das Wort“ sind. Heute steht ein faszinierendes Thema auf dem Lehrplan: Wie Worte Magie tragen können – und wie sie mit der richtigen Stimme und Kombination ganze Welten verändern.
Der Gedanke daran lässt mich frösteln. Denn ich beginne zu begreifen, dass nicht nur Zaubersprüche Macht haben – sondern auch die Worte, die Menschen füreinander wählen.
Der Unterrichtssaal ist in warmes, goldenes Licht getaucht. Über den Wänden schweben runenähnliche Zeichen, die sich bewegen, als würden sie atmen. In der Mitte steht Professor Ardelian – ein Mann mit einer Stimme, die selbst ohne Magie Macht besitzt.
„Worte“, sagt er, „sind die ältesten Zauber, die existieren. Man braucht keine Formel, keine Bewegung – nur Absicht. Der Ton bestimmt die Wirkung, das Herz die Richtung.“
Seine Worte hallen in mir nach. Ich sitze in der zweiten Reihe, neben Martina, die auffallend still ist. Sie schreibt nichts, beobachtet nur – mich.
„Wir beginnen mit einem einfachen Spruch“, fährt Ardelian fort. „Er offenbart, was im Inneren verborgen liegt. Wer die Kontrolle verliert, zeigt sein wahres Ich.“
Ich spüre, wie mein Herz schneller schlägt. Martina hebt die Hand.
„Darf ich es mit Jemea ausprobieren?“
Der Lehrer nickt.
Mein Magen zieht sich zusammen. Ernsthaft? Sie hätte mich wenigstens fragen können. Ich spüre, wie mir die Hitze ins Gesicht steigt – nicht aus Schüchternheit, sondern aus blanker Abneigung. Dieses Gefühl, übergangen zu werden, kenne ich zu gut. Professor Ardelian nickt nochmals, ohne zu zögern. Natürlich. Martina bekommt immer, was sie will. Ich balle unauffällig die Hände zu Fäusten unter dem Tisch. Ich will nein sagen, will aufstehen, will einfach raus – doch irgendetwas hält mich fest. Vielleicht diese unsichtbare Macht der Autorität. Vielleicht der Fluch, der mich zwingt, zu funktionieren. Ich zwinge mich zu einem Lächeln, das mehr wie eine Maske wirkt.
„Natürlich, gerne“, sage ich tonlos, obwohl alles in mir schreit: Nein!
Martina wendet sich zu mir, ihr Blick süß wie Honig, aber in ihren Augen glitzert etwas Kaltes.
Ich weiß, dass sie das genießt – mich vor allen bloßzustellen, die Kontrolle zu haben.
Professor Ardelian nickt ermutigend.
„Dann beginne, Martina.“
Und in mir wächst eine kalte Welle der Abwehr.
Ich will nicht. Ich kann nicht. Aber ich sitze da – und tue es trotzdem. Ihre Stimme klingt sanft, beinahe liebevoll, als sie spricht:
„Veritas lumen animae.“
– Das Licht der Wahrheit der Seele.
Ein warmer Wind streift meine Wangen. Für einen Moment sehe ich Licht – doch dann wird es dunkel. Bilder flackern vor meinen Augen: Amarena, der Tyrann, mein Spiegelbild mit diesen verfluchten Augen. Ich höre Stimmen, das Lachen des Meeres. Ich will schreien, aber kein Laut kommt über meine Lippen.
Martina flüstert leise: „Was versteckst du, Jemea?“
Ihre Stimme schneidet durch mich hindurch.
Ich spüre, wie mein Herz sich zusammenzieht, wie Magie in mir aufwallt, unkontrollierbar.
Die Lampen im Raum beginnen zu flackern.
Professor Ardelian ruft: „Genug, Martina!“
Aber sie hört nicht. Sie starrt mich an – neugierig, gierig, besessen.
„Zeig mir, was du bist…“
Ich springe auf, die Energie entlädt sich in einem leuchtenden Kreis um mich. Bücher fliegen, Runen zerreißen sich selbst in der Luft. Ein grelles Licht erfüllt den Raum, dann Stille. Ich keuche, schwitze, zittere. Martina sitzt da, bleich, fassungslos – und ein einziger Satz dringt aus meinem Mund, wie fremdgesteuert, aber doch von mir:
„Worte können retten. Oder vernichten. Und ich spreche nie wieder, wenn ich nicht weiß, wem ich zuhöre.“
Professor Ardelian blickt mich an, ehrfürchtig – und ein wenig ängstlich. Martina senkt den Kopf, doch ihr Mund formt ein kaum sichtbares Lächeln.
Martina hat ihren Zauber beendet, und das flackernde Licht im Raum beruhigt sich. Doch in mir tobt ein Sturm. Ich kann ihre selbstzufriedene Haltung kaum ertragen. Dieses unschuldige Lächeln – diese gespielte Demut.
„Jetzt bin ich dran“, höre ich mich sagen, meine Stimme kalt und leise, aber vibrierend vor unterdrückter Wut. Professor Ardelian will etwas erwidern, doch ich ignoriere ihn. Ich starre Martina an. Sie hebt nicht einmal den Blick.
Ich atme tief ein, meine Finger zittern, als ich die Worte forme.
„Intentionem tuam manifesta!
Aperi veritatem cordis tui.“
Zeige deine wahre Absicht!“
Öffne die Wahrheit deines Herzens.“
Kaum habe ich sie ausgesprochen, ändert sich die Luft. Ein grelles, silbernes Licht bricht zwischen uns hervor – und plötzlich sehe ich es.
Martinas Augen. Sie sind schwarz, tief, endlos – und in ihnen tanzen Schatten. Kein Licht, kein Leben, nur Dunkelheit. Hinter ihr formen sich Ketten aus glühendem Metall, umwickeln ihre Schultern, ihre Handgelenke, ihre Kehle. Sie klingen, klirren, bewegen sich – als lebten sie.
Mein Herz rast. Ich sehe, wie sich die Ketten über den ganzen Raum ausbreiten, über die Wände kriechen, über die Bücherregale, bis sie überall sind – als würden sie mich beobachten.
Überall, wo ich hinsehe, ist sie. Martina.
In jeder Spiegelung, in jedem Schatten.
„Was… was bist du?“, flüstere ich.
Das Licht meiner Magie pulsiert auf, zuckt, wird schwächer. Ich breche den Spruch ab, reiße die Hände zurück. Die Vision zerfällt, doch das Gefühl bleibt – diese kalte Präsenz, die mich nicht mehr loslässt. Ich sehe sie an. Sie sitzt still da, als wäre nichts geschehen. Ihr Kopf leicht gesenkt, die Hände gefaltet, das Gesicht friedlich – doch ihre Lippen formen ein kaum sichtbares, unheimliches Lächeln. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Ich weiß nicht, was ich gerade gesehen habe.
Ich weiß nur, dass es echt war. Der Unterricht ist endlich vorbei. Ich stürme aus dem Saal, ohne Martina auch nur eines Blickes zu würdigen.
Eine dunkle Wut brodelt in mir, heiß und unruhig wie Lava unter dünnem Glas. Warum sind wir überhaupt Freunde? Diese Frage hämmert in meinem Kopf, immer wieder, wie ein Fluch, der sich weigert zu enden. Mit schweren Schritten laufe ich durch den Flur, das Echo meiner Schritte hallt wie dumpfer Donner zwischen den Mauern. Ich will nur weg – weg von diesem Raum, weg von ihr, weg von allem. In der Kantine lasse ich mich an einem Tisch nieder, ohne mir etwas zu essen zu holen. Meine Arme sind verschränkt, der Blick leer auf einen Punkt in der Ferne gerichtet, als könnte ich darin Antworten finden. Doch natürlich, wie ein unaufhaltsames Schicksal, taucht sie wieder auf. Martina.
Sie folgt mir, leise, fast schleichend, wie ein Schatten, der sich nicht abschütteln lässt.
Dann setzt sie sich mir gegenüber, den Kopf gesenkt, ohne ein Wort. Ich spüre, wie meine Kiefer sich anspannen. Warum ist sie immer da? Warum verfolgt sie mich so?
Martina ist… anders.
Sie hat keine Freunde, gehabt. Niemand weiß so recht, was sie antreibt. Sie redet kaum, beobachtet viel – fast zu viel – und ihre Art ist so eigen, dass die anderen sie meiden. Und doch, irgendwo in ihrem kleinen Nerd-Universum aus Animes und Games hat sie ihre Nische gefunden. Ich vermute, dass es dort… seltsam zugeht. Vielleicht sogar verstörend. Trotz allem kann ich nicht wirklich böse auf sie sein. Irgendetwas in mir – etwas, das ich selbst verachte – empfindet Mitleid. Ich seufze tief, verdrehe die Augen und frage schließlich:
„Willst du was essen?“
Sie hebt den Blick nicht, doch ich sehe, wie ihre Schultern leicht zucken – als hätte sie nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt mit ihr rede.
Und genau in diesem Moment – als die Spannung beinahe greifbar wird – tritt Danny auf die Szene.
Er wirkt erschöpft, trägt ein paar blaue Flecken, aber sein Lächeln ist so hell, dass es fast den Raum erleuchtet. Seine Freude ist ansteckend.
„Hey, ihr beiden!“, ruft er, beinahe außer Atem. „Ich hab’s geschafft! Ich hab die Prüfung bestanden!“
Er strahlt wie ein Kind, das zum ersten Mal Magie gesehen hat, und schwenkt triumphierend ein kleines Zertifikat in der Hand.
„Das muss gefeiert werden! Was haltet ihr davon, wenn ich euch beiden was zu essen spendiere?“
Seine Begeisterung schwappt über wie Licht über Dunkelheit. Sogar Martina hebt kurz den Kopf, und – für einen flüchtigen Moment – huscht ein echtes, fast schüchternes Lächeln über ihr Gesicht.
Ich kann gar nicht anders, als zu nicken. Danny hat diese Art, selbst die schwersten Schatten ein Stück weit heller zu machen.
„Klar, gerne!“, sage ich und spüre, wie meine Stimme weicher klingt, als ich wollte. „Aber zuerst, erzähl mir: Was genau hast du bestanden?“










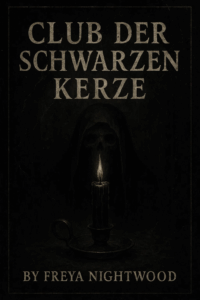






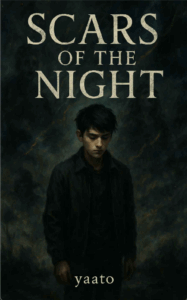

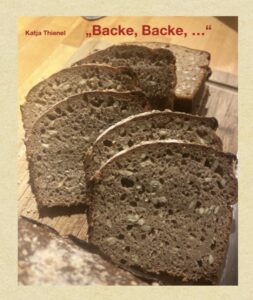








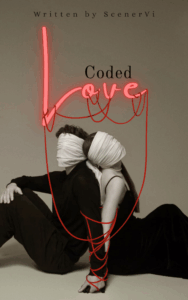





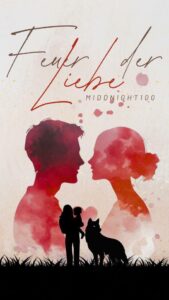

Kommentare