Kapitel 9 – Der Weg aus dem Schloss

Kapitel 9 – Der Weg aus dem Schloss
Aurelie
Mit schleppenden Schritten endete ich keuchend in der Küche und brach zusammen. Mein anfängliches Rennen war durch Ashurs Gift schnell zu einem müden Laufen und schliesslich zu einem kaum noch richtigen Gehen geworden.
Mit letzten Kräften zog ich mich am Boden entlang, in eine kleine Nische hinein, wo man mich hoffentlich nicht finden würde. Meine Muskeln brannten aufgrund des Giftes, welches mir mein Bruder injiziert hatte.
Nein! Nicht mein Bruder! Jetzt weniger als jemals sonst!
Wenn jemand herausfand, dass ich noch lebte! Wenn sie herausfanden, dass sie nicht die ganze königliche Familie erwischt hatten …!
Ein gehustetes Schluchzen, unterdrückt von der zittrigen Hand auf meinem Mund, zeugte von der quälenden Leere, die Alexanders Tod in meinem Innern hinterlassen hatte. Trotz allem war er mein Bruder gewesen. Trotz allem hatte ich ihn geliebt.
Ashur war anders. Mit ihm hatte ich mir nicht den Mutterleib geteilt. Er war älter und immer schon grausamer gewesen, auch wenn mir das Ausmass seiner Grausamkeit erst kürzlich wirklich bewusst geworden war.
Meine Zähne bibberten, mein ganzer Körper zitterte und zusätzlich brannte jeder Teil von mir im verzweifelten Versuch, das Gift des Kronprinzen wieder loszuwerden. Aber der Kampf in mir machte mich müde. Und während ich mir darüber im Klaren war, dass ich aus dem Schloss, aus dem Land fliehen musste, und das eigentlich schon gestern, erschlaffte mein Körper und meine Lieder wurden schwer.
„Asha! Wach auf, Kleine!“
„Irina?“, nuschelte ich leise, irritiert von ihrem gestressten Ton. Dennoch zwang ich meine schweren Augenlider, sich zu öffnen.
„Wir müssen gehen! Wir sind frei. Der Fürst hat alle Sklaven frei gelassen!“
Mein Kopf war noch zu müde, um zu begreifen, was sie mir damit sagen wollte. Wie viel Zeit war vergangen? Es konnte nicht sehr viel gewesen sein, denn ich spürte das Gift meines Bruders nach wie vor das Innere meines Körpers verätzen. Und das würde es vermutlich auch noch eine ganze Weile.
„Ich kann nicht…“, flüsterte ich heiser, was Irina die Stirn runzeln liess. „…gehen. Ich kann nicht gehen, Irina. Ashur hat mich gebissen“, hauchte ich müde, versucht, einfach wieder die Augen zu schliessen.
„Verflucht! Bei den Göttern! Dieser Vampir gehört…!“
„Kinder anwesend“, scherzte ich schwach, brachte sie damit aber zum Verstummen. Ihre Stimme, um genau zu sein, jeder einzelne Laut, war einer zu viel. Selbst meine eigene Stimme dröhnte viel zu laut in meinem Kopf. Es war geradezu barbarisch. Und mein Kopf antwortete mit einem pochenden, aufdringlichen Schmerz in meinen Schläfen.
Kurz schaute mich Irina prüfend an. „Ich werde dich nicht anlügen, Asha. Ich bleibe nicht hier. Ich war mein ganzes Leben lang Sklave in verschiedenen Haushalten und überall war es besser als hier! Wir könnten uns ein ganz normales Leben aufbauen. Irgendwo ganz weit im Osten, wo Menschen eigenständig leben dürfen. Wo es für uns … mich … uns ganz andere Lebensumstände geben wird! Wo Menschen keine Sklaven sein müssen!“ Kurz hielt sie inne in ihrem Monolog, unsicher auf mich hinabblickend.
„Schon gut. Ich weiss, ich bin kein Mensch. Ich bin ein Vampirkind, das seine Reife nicht erreicht. Aber solange, das so ist, bin ich noch viel weniger als ein Mensch, also nur keine Scheu.“ Ich lachte gezwungen auf, wobei mich allein das schon unfassbar anstrengend dünkte. „Ich bin kein Stück besser als du oder sonst ein Mensch, Irina. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, ohne dich.“
„Im Kerker, grün und blau geschlagen“, murmelte sie leise, vermutlich nicht mit der Absicht, dass ich sie hörte. Ein etwas besseres Gehör als Menschen und eine leicht bessere Nase besass ich trotz allem und so lächelte ich träge, obschon mir jeder Muskel schmerzte. „Du ruhst dich jetzt noch kurz aus. Ich werde ein paar Vorräte zusammenpacken.“
Wollte sie jetzt das Schloss bestehlen? Mit diesem Gedanken sackte ich auch schon wieder in die Vergessenheit.
„Na komm!“ Mit diesen Worten fasste mir Irina wenige Minuten später unter die Arme und zog mich hoch. Keuchend kam ich neben ihr zum Stehen, die Beine zitternd unter meinem Gewicht. „Wenn es sein muss, dann trage ich dich eben“, knurrte sie angestrengt und setzte sich in Bewegung. In der freien Hand, die mich nicht stützen musste, hielt sie einen kleinen Leinensack mit frischen Vorräten fest.
Zielsicher steuerten wir auf den Bedienstetenausgang zu. Dort sahen wir aber schon von weitem zwei Soldaten stehen. Gross, stark, Grigoroi. Einer davon Ulras.
Entsetzt weiteten sich meine Augen. Er würde mich niemals gehen lassen! Wieso lebte er überhaupt noch? Er gehörte doch den Reihen des Königs an! Er sollte genauso tot sein, wie …! Ich schluckte.
Auch Irina kam abrupt zum Stehen, sobald sie die beiden Grigoroi am Ausgang erkannte. Und noch ehe wir hätten umdrehen können, hatte Ulras mich entdeckt. Ein grausames Grinsen breitete sich auf seinen Zügen aus und verhiess nichts Gutes. Plötzlich stiess ihm der andere Grigoroi aber mit dem Ellbogen in den Bauch und raunte ihm etwas zu, was ich nicht verstehen konnte. Dafür waren wir noch zu weit weg.
So oder so, Ulras sah nicht besonders glücklich aus und feixte den anderen Grigoroi einen Moment lang abschätzend, ehe er seinen Blick wieder zu mir wandte und seinen Posten wieder einnahm. Er würde nicht auf uns zukommen. Aber genauso wenig würde er uns durchlassen. Ulras wäre nicht Ulras, wäre er gutherzig. Also kehrten wir um.
„Wir nehmen den Hauptausgang. Dieser Fürst hat uns immerhin freigelassen!“, murmelte Irina neben mir und ich nickte bekräftigend. So machten wir uns auf den Weg durchs Schloss bis hin zu den Haupttoren.
Mich neben ihr her schleifend, dauerte der Weg sicher fünfmal so lang wie normalerweise. Und wie wir so durch die ganze Stadt und noch weiter kommen sollten, blieb mir ein Rätsel. Dennoch nahmen unsere Schritte an Geschwindigkeit zu, als die grossen Tore vor uns in Sichtweite kamen. Die Freiheit rief regelrecht nach uns! Die Tore waren geöffnet und nur zwei Wachen standen zu beiden Seiten positioniert. Sie beiden sahen aber nur passiv dabei zu, wie Sklaven hinausschritten. Es mussten schon hunderte draussen sein. Mittlerweile kamen nur noch vereinzelt Nachzügler durch die Tore.
Direkt vor uns lief eine kleine Gruppe Nachzügler. Drei Mädchen unterschiedlichen Alters und ein Junge. Alle waren sie abgemagert. Teils konnte man noch frische Bisswunden sehen.
Gerade als sie die Tore passierten, schritt eine der Wachen ein und packte ein Mädchen aus der Gruppe grob am Arm. Er zog sie aus der Gruppe hinaus und hielt sie einer Frau hin, die plötzlich neben ihnen stand. Vielleicht hatte ich sie vorhin auch einfach nur nicht bemerkt.
Das Mädchen schrie auf und versuchte ängstlich, sich gegen den festen Griff der Wache zu wehren. Aber trotz aller Kraft hatte sie keine Chance gegen einen Grigoroi.
„Was wollt ihr von mir! Er hat gesagt, wir sind alle frei! Er hat es versprochen!“, kreischte sie verzweifelt, als sie bemerkte, dass sie von der Gruppe getrennt wurde. Ihr blondes Haar peitschte wild um ihr Gesicht.
Die Frau neben der Wache war grossgewachsen, hatte volle Lippen; sie war ein Abbild äusserlicher Schönheit. Genauso wie Irina. Nur dass Irina sich nie mit teurem Schmuck schmücken oder sich in solch kunstvolle Gewandungen hatte kleiden können. An Irina prangten die Narben der Sklaverei, innerlich wie äusserlich. Aber auf der beinahe weissen Haut dieser blonden, langhaarigen Schönheit war nirgendwo auch nur eine Narbe zu erahnen.
„Sehr gut“, antwortete diese gerade der Wache, wobei sie deutlich lauter sprach, als die Wache selbst. Noch während sie sprach, griff sie unsanft nach dem Handgelenk des jungen Mädchens. „Sonst keine weitere?“
Ich verspannte mich. Was sollte das bedeuten? Suchten sie … nein.
„Irina!“, flüsterte ich leise, zitternd, ängstlich. „Sie suchen…“
„Da ist noch eine!“, rief die Wache, die bisher nur passiv neben den anderen beiden gestanden hatte. Und mit seinem Finger zeigte er direkt auf mich.
„Au! Ich habe nichts getan!“, rief das blonde Mädchen empört, als sie schwungvoll in eine vor Schmutz und Gestank nur so triefende Zelle hineingeworfen wurde. Ihr Ellbogen schlug auf dem Boden auf und sie sog zischend die Luft ein.
Ich hatte auch noch weitere Frauen hier unten gesehen. Allesamt blond, doch die meisten deutlich älter als ich.
„Ich gehe freiwillig!“, warf ich schnell ein, wurde aber dennoch genauso unsanft hineingestossen, wie das Mädchen vor mir. Vermutlich empfand mich der fremde Grigoroi nicht als sonderlich folgsam. Immerhin musste er mich bis hier her tragen. Nicht etwa, weil ich mich grossartig gewehrt hätte, nein. Viel eher, weil ich kaum stehen, geschweige denn eigenständig gehen konnte.
Mit einem schmerzerfüllten Wimmern kam ich am Boden auf, drehte mich um und hielt mir leise weinend meine Hand an den Brustkorb. Meine Rippe pochte stark; mein Körper zerriss innerlich aufgrund des Giftes.
Mit einem Quietschen und einem darauffolgenden Krachen wurde die Kerkertür wieder zugedrückt. Das Geräusch von Metall auf Metall verkündete, dass wir eingeschlossen worden waren.
Schwach drückte ich mich aus dem Schlamm hoch. Obwohl … Schlamm war es sicherlich keiner, aber was das genau war, wollte ich eigentlich gar nicht so genau wissen. Ich sah mich um und erkannte das blonde Sklavenmädchen, welches direkt vor mir an der Tür war. Und sie hatte sich zur Wehr gesetzt. Sie hatte sich wirklich gegen einen Grigoroi zur Wehr gesetzt! Dabei waren wir so viel weniger Wert!
Mich hingegen schaute sie an, als wäre ich Abschaum. „Was guckst du so?“, fuhr sie mich an, eine Arroganz in ihrer Stimme, die von einer für mich undenkbaren Freiheit zeugte. Sie konnte noch nicht besonders lange Sklave gewesen sein. Aber was sollte sie sonst ihr Leben lang gemacht haben?
„Wieso hast du dich gewehrt?“, fragte ich mit rauer, kraftloser Stimme, allerdings ehrlich neugierig. Ihren herabwürdigenden Ton ignorierte ich gekonnt. Ich befürchtete schon, meine Stimme ginge im lauten flüstern der anderen Gefangenen unter, doch die Reaktion des Mädchens sagte etwas anderes.
Ungläubig sah sie zu mir hinunter, dann wurde ihr Blick wütend. „Nur weil sie Vampire sind, können sie sich doch nicht alles erlauben! Sie haben uns freigelassen! Damit haben sie kein Recht mehr darauf, mich gefangenzuhalten!“ Während ihrer letzten Worte wurde sie immer lauter, bis sie schliesslich wütend gegen die Zellenstäbe schlug.
Ich zuckte zusammen. „Bitte. Mach sie nicht wütend“, flehte ich ängstlich, während mein Kopf vom Geräusch der klirrenden Eisenstäbe dröhnte.
Das Mädchen schnaubte angriffslustig.
Da kam plötzlich eine Stimme von hinter uns: „Sie hat recht, weisst du. Du solltest niemanden wütend machen, der über dir steht.“
Blitzschnell drehte sich das andere Mädchen um, während ich einen Moment länger dafür brauchte. Vor uns sass ein anderes, ein drittes Mädchen am Boden, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Sie war genauso blond wie wir, hatte aber kürzeres Haar als meines. Es reichte ihr nur knapp über die Stirn. Ihre Augen waren getaucht in ein helles Blau und ihre Ausstrahlung war so ruhig und entspannt, wie es ihre Stimme vermuten liess.
„Es steht aber niemand über mir!“, knurrte das blonde Mädchen neben mir aggressiv. Sie selbst hatte längere Haare als ich. Auch etwas dunkler, wenn ich mich nicht täuschte. Ihre Augen funkelten grün und kampfbereit. Exakt dasselbe sagte ihre Haltung über sie aus.
„Du wurdest eingesperrt. Sie stehen über dir, weil sie stärker sind als du. Die Starken leben, die Schwachen sterben. So läuft das in dieser Welt“, erwiderte das sitzende Mädchen nüchtern und flüsterte leise: „Hohlbirne“, hinzu, wobei das aggressive Mädchen letzteres nicht gehört zu haben schien.
Diese war auch schon wieder heftig dabei zu protestieren, was ich nach kurzem allerdings erfolgreich ausblenden konnte. Ich legte mich auf den Boden, zu müde, um den Weg bis zur Zellenwand auf mich zu nehmen.
„Was ist mit dir?“, fragte die Besonnene besorgt und unterbrach damit die Angriffslustige in ihrem Monolog.
„Was soll mit ihr sein?“, fuhr diese die Besonnene an und wandte sich mir zu. „Oh.“
Meine Augen waren halb geschlossen. So, dass ich noch sehen konnte, was um mich herum geschah. Dennoch klang der Schmerz nicht ab. Ich war so müde. Ich hatte den ganzen Tag noch keine Gelegenheit dazu gehabt, etwas zu mir zu nehmen und ich konnte noch nicht einmal sagen, welche Zeit, oder gar welchen Tag wir schrieben. Wie lange hatte ich geschlafen? Eine Stunde, einen Tag?
„Geht es dir nicht gut?“, wollte die Angriffslustige, die ich persönlich ja für verrückt hielt, wissen und kniete sich stirnrunzelnd neben mich.
„Alles gu…“ Meine Antwort wurde von einem unerwarteten Hustenanfall unterbrochen. „Scheisse“, hauchte ich danach müde und schloss die Augen.
„Ihr geht’s gut“, hörte ich die Angriffslustige sagen, während sie sich wieder aufrichtete und sich zackigen Schrittes von mir wegbewegte. „Also. Wie kommen wir hier raus?“ Dieses Mädchen hatte sie nicht mehr alle, da war ich mir sicher.
„Natürlich. Ganz offensichtlich geht es ihr gut. Deshalb hat sie gehustet wir eine Sterbende.“
Das Wort schockierte mich. Sterben? Sah ich etwa so schlimm aus? War ich schon so schwach?
Die Stunden vergingen und es geschah nichts. Die Besonnene gab ihre Einwände auf, die Angriffslustige verlor die Motivation. Die beiden Mädchen waren nur meinetwegen hier drinnen, das war mir sehr wohl bewusst. Und es tat mir leid. Was auch immer die Fürsten von mir wussten, sicher war, sie wussten um mein blondes Haar. Es war das gleiche Blond, welches auch Alexander getragen hatte. Und doch war es eine äusserst selten anzutreffende Farbe. Ein so helles Blond, dass es im Mondlicht beinahe schon weiss schimmerte. So wurde es zumindest immer beschrieben. Und meine Augen sollten im Licht der aufgehenden Sonne zu ihren Ebenbildern werden. Die Sonne würde den Bernstein in meinen Augen zum Glühen bringen, hatte mir Alexander einmal gesagt. Darauf war er als Kind immer neidisch gewesen, denn er selbst hatte nur ganz normale, braune Augen … gehabt. Gehabt. Vergangenheit. Alexander war tot. So wie der Rest meiner Familie.
Dabei verstand ich nicht, wieso sie nach mir suchen sollten. Ich war vor drei Jahren für tot erklärt worden, das hatte mir Ashur mit einer solchen Euphorie erzählt, dass es unmöglich eine Lüge hätte sein können. Dafür war die Freude über mein Leid zu gross gewesen.
Aurelie war tot. Ich hatte diesen Namen Jahre schon nicht mehr genutzt! Ich hiess Asha! Nur Asha!
„Wie heisst ihr?“, flüsterte ich leise, unsicher, ob sie mich überhaupt hören konnten.
„Aurillia“, antwortete die Angriffslustige.
„Emili“, entgegnete die Besonnene zaghaft.
Ich nickte langsam.
„Und du?“, wollte Aurillia wissen.
„Asha“, murmelte ich leise, noch immer zusammengerollt auf dem Boden im Dreck liegend. Ich hatte mich vermutlich seit Stunden nicht bewegt. Aber das Brennen wurde auch nicht so recht besser. Ich verstand es nicht richtig. Hatte Ashur mir etwa absichtlich sein Gift injiziert? Hatte er mir mehr gegeben, als ein Vampir beim Beissen normalerweise absonderte? Oder war ich nur noch viel schwächer, als ich gedacht hatte?
Wenn ein Vampir seine Fänge in die Haut eines Menschen versenkte, so gab er immer ganz kleine Mengen von seinem Gift ab. Dieses Gift machte Menschen mit der Zeit süchtig. Für den Moment sorgte es aber für eine schnellere Blutgerinnung, wenn er die Fänge wieder zurückzog. Dieses bisschen Gift wurde immer abgegeben. Darauf hatte der Vampir keinen Einfluss. Wenn er aber absichtlich viel Gift absonderte, erzeugte das bei Menschen einen Herzstillstand. Sie starben und wandelten sich zu Grigoroi. Für jeden Menschen war es eine Ehre, zum Grigoroi auserwählt zu werden. Es bedeutete ein längeres Leben, Stärke und Geschwindigkeit. Alles Attribute, die Menschen normalerweise verwehrt blieben.
Ein Vampir aber machte das Gift eines anderen Vampirs schläfrig und träge. Im Gegensatz zu Menschen griff es bei Vampiren den Körper an, der dieser Vergiftung mit seinem eigenen Gift entgegenwirken konnte.
Mein Problem war nur, dass man eigenes Gift erst nach seiner Reife zu produzieren begann. Mein Körper musste also gegen Vampirgift ankämpfen, ohne die Mittel dafür zu haben. Ein weiterer Grund dafür, wieso Vampirkinder eine Schwäche schlechthin waren. Alles an uns war schwach und bedürftig. Geistig konnten wir nur so weit fortschreiten, wie unsere körperliche Entwicklung es auch zuliess.
Dennoch hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich so lange dagegen zu kämpfen hätte.
Irgendwann wachte ich auf. Ich musste eingenickt sein. Die anderen beiden aber ebenfalls, denn von ihnen hörte ich nur langsames, regelmäßiges Atmen. Und immer noch schmerzte mein Körper, als würde er von innen verätzt. Ich verstand nicht, wie es sein konnte, dass ich diesem Gift rein gar nichts entgegenzusetzen zu haben schien!
Aber natürlich gab es auch kein wirkliches Wissen dazu, wie ein Vampirkind auf das Gift reagierte. Immerhin galten wir als heilig. Keiner würde es wagen … nun, sollte man zumindest meinen.
Zitternd legte ich meine Hände auf den kalten, nassen Boden ab und drückte mich hoch.
Die Fackel sandte von ausserhalb der Zelle warmes, aber schwaches Licht hinein und so konnte ich die anderen beiden erkennen.
Aurillia zuckte, drehte sich im Schlaf und erschauderte kurz, ehe sie sich scharf ausatmend wieder beruhigte.
Und da roch ich es. Meine Nase zuckte entzückt. Neugierig, wo noch keine Neugierde sein dürfte. Trotzdem näherte ich mich unversehens Stück für Stück der unruhig schlafenden Aurillia. Ich kroch über den grausig stinkenden Boden, doch das Odör des Blutes wog schwerer. Ihren Ellbogen, der beim Sturz in die Zelle aufgerissen sein musste, hatte sie sich im Schlaf weiter aufgerissen. Mit irgendeiner unbedachten Bewegung oder Drehung. Schlussendlich war es mir gleich. Ich roch nur das Blut und ich wurde davon angezogen, wie eine Motte vom Licht. Ich wühlte mich durch den Dreck, bis ich bei dem risikofreudigen Mädchen angekommen war, mein Mund nur noch einen Wimpernschlag von ihrem Ellbogen entfernt.
Ohne darüber nachzudenken, legte ich meine warmen Lippen auf ihre kalte Haut und fing tatsächlich an zu saugen. Was mich sonst immer abgeschreckt hatte, was ich sonst immer zum Grausen fand, und doch nicht fähig gewesen war, wegzusehen, wenn meine Familie sich zum Abendmahl einen Sklaven herbeirief, rief mich nun wie einen alten Freund herbei.
Früher hatte ich nie den Blick abwenden können, wenn meine Familie von Menschen getrunken hatte. Doch war dies weniger einer unerklärlichen Neugierde oder Schadenfreude zuzuschreiben gewesen, als mehr einem tiefgehenden Mitleid, welches ich für jedes einzelne Opfer empfunden hatte, bis es mich innerlich fast zerriss. Als ich zum Sklaven degradiert worden war, hatte ich begonnen, wegzusehen. Denn von da an hatte ich nur noch mich gesehen, an Stelle des Sklaven. Mich, den Fängen meiner Familie hilflos ausgeliefert.







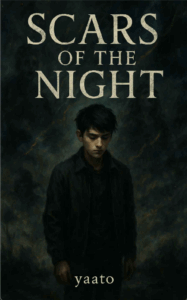

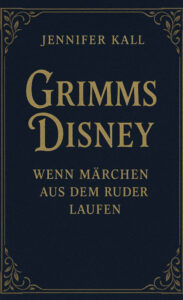










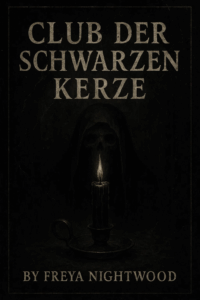









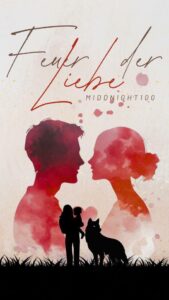



Kommentare