32. Glücksterne


Wenn Maren und ich allein sein wollten, gingen wir meistens zu mir.
Noch nie hatte sich jemand so sehr für mich interessiert. Ihre Fragen schienen kein Ende nehmen zu wollen. Erst antwortete ich bloß zögernd, konnte mich einfach nicht durchringen, so viel über mich zu sprechen. Außerdem erschien mir mittlerweile alles, was sich vor Schönhagen abgespielt hatte, eigenartig fremd und unwirklich.
Aber nach und nach taute ich doch auf. Begann von Hartmann und den verschiedenen Cliquen zu erzählen, vom Bunker, schließlich sogar von den Solterbeck-Leuten. Wie sie uns terrorisiert und gejagt hatten, wie ich von ihnen zusammengemöbelt worden war. Selbst meine anschließende Panik und den Verfolgungswahn sparte ich nicht aus.
Stundenlang konnten wir zusammensitzen und quatschen. Wir vergaßen die Zeit, achteten nicht darauf, ob es regnete oder die Sonne schien. Es gab nur noch unser Gespräch, unser Ritual aus Fragen, Erzählen und Nachfragen.
Manchmal ging der Übermut mit mir durch. Zum Beispiel drehte ich bei einem unserer Treffen die Musik voll auf – Nordstadt-Mucke. Es sollte richtig schön krachen. Ich wollte demonstrieren, was ich vorher bloß mit unbeholfenen, platten Sätzen geschildert hatte. Im ersten Moment wirkte Maren tatsächlich beeindruckt. Aber bald wandelte sich ihr Gesichtsausdruck, zeigte erst Skepsis, dann Abneigung und sogar einen Hauch von Verachtung. Ich regte mich innerlich total auf, dachte: Du Spießertussi! Erst fragst du mich vom Hundertsten ins Tausendste über die Nordstadt aus, aber wenn du sie mal hörst, die Nordstadt, kriegst du sofort nasse Füße. Ist dir die Mucke zu hart? Bringt sie dir das wahre Leben, das Chaos, zu nahe? Willst du lieber in deiner heilen Welt bleiben, du Provinzlerin? Dann kam mir, was dort aus den Boxen schepperte, plötzlich selbst völlig aufgeblasen vor, künstlich und hohl. Man wollte Eindruck damit schinden, auf Dicke Hose machen. War das hier draußen wirklich noch nötig? Hatte sich diese Tour nicht längst überlebt? Schließlich würgte ich die Musik kurzerhand wieder ab. Solche Wechselbäder der Gefühle gab es immer wieder. Erst war alles locker und unkompliziert. Man konnte die Dinge einfach dahinsagen, ohne langatmige Erklärungen und Erläuterungen. Aber dann schnitt man ein Reizthema an, ließ ein falsches Stichwort fallen – und mit einem Schlag war alle Nähe verschwunden, trennten uns wieder Welten.
Dennoch hatte ich den Eindruck, als würden diese Situationen seltener, als bewegten wir uns allmählich aufeinander zu. Und mit dieser Veränderung kam ein Gefühl zum Vorschein, das ich bisher nicht gekannt hatte: Vertrauen. Ich begann ihr Dinge zu sagen und zu zeigen, die ich aller Welt bis dahin sorgfältig verschwiegen hatte.
Zum Beispiel durfte eigentlich niemand wissen, dass ich Meditationsmusik hörte. „Meditationsmusik“ – in der Nordstadt war das ein Schimpfwort gewesen. Nur Hippies, Körnerfresser und weltfremde Spinner fanden so was gut. Ich versteckte die entsprechenden Platten immer ganz weit hinten im Schrank. Kaum auszudenken, wenn jemand sie bei mir gefunden hätte. „Hauke ist unter die Gurus gegangen“, hätte es geheißen, oder: „Hauke will nach Indien auswandern“. Ich wäre zum Deppen gestempelt worden, niemand hätte mich mehr für voll genommen.
Aber bei Maren hatte ich das Gefühl, aus meiner Faszination für diese Musik keinen Hehl machen zu müssen. Ich ging aufs Ganze, legte eine Scheibe auf. Losgelöste Klänge waberten durch den Raum. Oft gab es keine richtigen Melodien, bloß verschiedene Tonfolgen und Akkorde, die sich vermischten, gegenseitig überlagerten, wieder auseinanderliefen. Zuerst fühlte ich mich gut, die Musik trug mich davon. Doch je länger das Stück dauerte, desto mulmiger wurde mir. Ich hatte das Gefühl, auf dünnem Eis zu sein. Durfte ich Maren ernsthaft so was vorspielen? Hatte ich mich getäuscht?
„Die Musik ist schön“, meinte sie nach einiger Zeit mit verträumtem Gesichtsausdruck. „Aber auch komisch. Sie lockt dich, zieht dich, und wenn sie dich hat, nimmt sie dir alle Kraft. Man will gar nicht mehr zurückkehren ins Draußen, ins Hier.“
Erst verstand ich nicht, was sie meinte. Dann wurde mir klar, dass ihre Worte genau das ausdrückten, was ich mir insgeheim beim Hören solcher Platten immer wünschte – abhauen, verschwinden, niemals mehr zurückkommen ins normale Leben, die Wirklichkeit mit ihren Problemen, Missverständnissen, täglichen Kämpfen…
Da war sie wieder, diese Maren-Souveränität, die mich schon zu Anfang beeindruckt hatte. Der Scharfsinn, mit dem sie die Dinge durchschaute und auf den Punkt brachte. Und ein weiteres Mal hatte es Ewigkeiten gedauert, bis bei mir endlich der Groschen fiel.
***
Die Sehnsucht nach ihrer Haut, ihrem Körper wurde immer stärker. Ich glitt in den Ärmel ihres T-Shirts, strich über die nackte Schulter, versuchte mich noch weiter vorzuarbeiten. Irgendwann stand sie auf, ging zum Fenster und machte den Vorhang zu. Sie stand dort, zögerte einen Moment. Dann drehte sie sich zu mir und zog T-Shirt und Bustier aus. Ihre Brüste waren sehr klein, bestanden fast nur aus den roten Höfen um ihre Brustwarzen. Sie kam zurück, legte sich wieder zu mir aufs Bett, umarmte mich.
Ich war wie erstarrt. Ungläubig begann ich, über ihren Rücken zu streichen, über ihre Seite. Ich spürte die Linie der Taille, den Ansatz der Brust. Marens Hände glitten unter mein T-Shirt, wollten es mir über den Kopf ziehen. Aber ich ließ es nicht zu.
Auf einmal kam ich mir völlig verklemmt vor. Dabei hatte ich von dieser Situation so oft geträumt: Ein Mädchen, das sich freiwillig auszieht, mit dem man richtig was anstellen kann. Und jetzt? Worauf wartete ich noch? Ran an den Speck, aber zackig!
Ich konnte die Erregung tatsächlich nicht länger zurückhalten. Stürzte mich auf Maren, presste sie auf den Rücken, streichelte und küsste ihre kindlichen Brüste, fühlte die Brustwarzen hart werden. Sie begann leise zu seufzen. Und als sie irgendwann wieder versuchte, mir das T-Shirt abzustreifen, wehrte ich mich nicht mehr, im Gegenteil: Ich half ihr mit hektischen, fahrigen Bewegungen, konnte es kaum abwarten.
Aber komisch: Je gieriger ich wurde, desto mehr zerstob mein Gefühl, verschwand ins Nirwana. Maren, eben noch meine Prinzessin, war plötzlich nur irgendein Mädchen zum Begrapschen, Rummachen und Sich-Aufgeilen, sonst nichts. Was passierte bloß mit meiner Liebe zu ihr, sobald unsere Körper ins Spiel kamen? Weshalb wurde aus Berühren und Streicheln jedes Mal schnell reine Fummelei? Irgendeine komische Lücke klaffte da in mir, die ich zwar überspringen, aber nicht schließen konnte.
Maren hatte dieses Problem nicht, bei ihr flossen Liebe und Lust nahtlos ineinander. Völlig ungezwungen offenbarte sie mir ihre Gefühle, brachte mir ein geradezu kindliches Vertrauen entgegen. Wie sehr ich mir wünschte, diese Hingabe erwidern zu können – aber es ging nicht.
Irgendwann verlor ich jedes Mal komplett den Faden, wurde völlig mechanisch. Ich kannte das aus der Nordstadt, dem Bunker, dort war es am Schluss auch immer so gelaufen: Ich hatte das Mädchen unter mir bearbeitet, als würde ich einen Job erledigen, meine Pflicht erfüllen.
Schließlich merkte Maren es. Oder besser: Ich merkte endlich, dass sie es gemerkt hatte. Längst schaute sie abwesend weg, ihr Körper hatte sich versteift. Ich rollte mich zur Seite, gab sie frei, erlöste sie.
Dann wich ich ihrem Blick aus, so lange es ging. Ich wollte nicht den stummen Vorwurf ertragen müssen, den ich garantiert sehen würde. Mein schlechtes Gewissen war auch so schon groß genug. Ich hasste mich regelrecht für das, was ich nicht besaß, nie besitzen würde. Ich war ein Nichts, ihrer unwürdig.
Schließlich schaute ich doch und stellte jedes Mal überrascht fest, dass ihr Blick nicht anklagend war, sondern voller Mitgefühl. Als wäre ich die bedauernswerte Person, nicht sie.
***
Zu Maren nach Hause ging ich bloß ungern. Ihr Alter schien irgendwas gegen mich zu haben. Sie behauptete zwar immer, das würde nicht stimmen, aber das konnte ich mir wiederum nicht vorstellen.
Genau genommen hatte ich den Typen bisher erst einmal getroffen, im Hausflur der Sührings. Er war gerade von der Arbeit gekommen und noch in Schlips und Kragen. Maren umarmte ihn, gab ihm einen Kuss auf die Wange. Dann schob sie mich nach vorn.
Er war fast einen Kopf größer als ich und schaute sozusagen auf mich herunter. Von Jürgen wusste ich, dass er einen wichtigen Job in Hoheneck hatte, im dortigen Großmarkt. So brav wie möglich sagte ich „Guten Tag“ und hielt ihm zaghaft die Hand hin. Er grüßte zurück, korrekt und gleichzeitig irgendwie frostig. Seine Pranke zerquetschte mir fast die Hand, sein Blick taxierte mich misstrauisch. Ich wurde immer kleiner, schrumpelte regelrecht in mich zusammen. Leider wollte sich seine Miene die ganze Zeit nicht entspannen; die Stirn blieb gerunzelt, die Falten schienen noch tiefer zu werden. Schließlich drehte er sich wieder zu Maren und ermahnte sie, nicht zu spät zum Abendbrot zu kommen.
Der Personencheck war wohl nicht günstig für mich ausgefallen. Wie auch? Wenn man bei mir den gut erzogenen Jungen aus soliden Verhältnissen suchte, fand man halt nichts. Es war exakt dieselbe Situation wie bei Dr. Busch, unserem Direx am Wilhelm-Gymnasium. Bei solchen Typen konnte man sich noch so abmühen – man blieb doch immer der Proll, der Untermensch.
Mit Frau Sühring kam ich deutlich besser klar. Sie arbeitete halbtags in einem Laden im Dorf und war, wenn ich nachmittags bei Maren klingelte, meist zu Hause. Dann kochte sie Tee, stellte uns manchmal selbstgebackenen Kuchen hin. Wir plauschten immer ein bisschen mit ihr, bevor wir nach draußen abhauten oder uns zu Maren aufs Zimmer verzogen. Ihre Mutter würde meine freundliche und „sensible“ Art mögen, berichtete sie, außerdem fände sie es gut, dass ich Maren abends immer bis zur Haustür brachte. Angeblich wüsste sie ihre Tochter bei mir „in guten Händen“.
Bei dem Gedanken, dass mich jemand „sensibel“ fand, musste ich insgeheim schmunzeln. Aber ich mochte Frau Sühring auch. Sie entsprach total dem, was ich mit dem Begriff „Mutter“ eigentlich verband: Sie kümmerte sich, war immer da, wenn man sie brauchte. Insgeheim wunderte ich mich, wie eine so sanfte Frau neben dem wuchtigen, sperrigen Herrn Sühring überhaupt bestehen konnte.
Aber auch zur Mutter wollte ich lieber auf Distanz bleiben, nicht zu viel Vertraulichkeit aufkommen lassen. Sonst riskierte ich, allmählich in Marens Familienleben hineingezogen zu werden, und dann hätte ich am Ende auch wieder Herrn Sühring gegenübergestanden. Darauf konnte ich gut verzichten.
Schade, dass es so kompliziert war. Weshalb konnte nicht alles so laufen wie zum Beispiel wie bei Hartmanns Eltern? Denn eigentlich war ich gern bei Maren, fühlte mich bei ihr sauwohl. Ihr Zimmer war ziemlich klein. An der Rückwand befand sich der Einbauschrank; das Bettsofa war mitten im Zimmer postiert, was ich ziemlich cool fand. Ein Regal mit Büchern und Krimskrams neben dem Fenster sah man bereits von unten. An der gegenüberliegenden Wand hing ein Poster, die Schwarzweiß-Fotografie eines Kindergesichtes mit blonden, zerzausten Locken und Schmollmund. Erst dachte ich, das wäre Maren – als Kind musste sie genauso ausgesehen haben. Aber sie erzählte mir, dass das Bild in der Bibliothek ihrer Schule gehangen hatte. Als die Gelegenheit günstig war, hatte sie es mitgehen lassen.
Darunter waren Schnappschüsse angepinnt. Auf einem stand Maren vor einer verschneiten Landschaft, in dunkelblauer, wattierter Jacke, um den Hals mehrere Schals in verschiedenen Farben. Ein Stirnband hielt das Haar aus dem Gesicht. Sie lachte in ihrer typischen Art, mit leuchtenden Augen und nach unten gezogenen Mundwinkeln, während ihre Nasenflügel sich krausten. Die Hände steckten in grauen Wollhandschuhen und waren abwehrend erhoben, als wollte Maren nicht, das man sie fotografierte. Die eine Hälfte ihres Gesichts war von der tiefstehenden Sonne rötlich gefärbt, in den Augen spiegelte sich das Licht. Es sah unfassbar schön aus.
„Wann war das?“ Ich zeigte auf das Bild.
„Im vorletzten Winter.“
„Und wer hat das aufgenommen?“
„Jürgen, glaube ich“, sagte sie nach kurzem Schweigen.
Bei meinem nächsten Besuch hing das Winterfoto nicht mehr dort.
In einer Ecke des Raums stand eine Nähmaschine, die ziemlich professionell wirkte. Schneidern war Marens Hobby. Sie nähte Hosen und Kleider mit schrillen Mustern aus den Fünfzigern und Sechzigern. Manchmal trug sie die Klamotten selbst, aber meist verschenkte oder verkaufte ihre Werke. Auch die Vorhänge mit dem grellbunten, verrückten Muster entstammten ihren Nähkünsten. Sie hatte den Stoff auf irgendeinem Flohmarkt entdeckt und sofort gekauft.
Beim allerersten Eintreten hatte der Mann im Mond mich verschmitzt lächelnd begrüßt: „Wir kennen uns ja bereits“, schien er mir zuzuraunen. Auf der Fensterbank unter ihm lag eine Handvoll blauer, flacher Steine. Ich hatte sie zunächst nie recht beachtet und erst später erkannt, dass sie aus Glas waren. Ihre dunkelblaue Farbe strahlte etwas zutiefst Beruhigendes aus. Einige waren kreisrund, andere hatten eine angedeutete gezackte Form, wie Sterne. Der Sternenhimmel. Und darüber der Mond.
Eines Nachmittags, als wir wieder bei Maren waren, erzählte ich ihr von meinem Absturz in der Schule und dem katastrophalen Halbjahreszeugnis. Schilderte, wie ich mich langsam aus dem Schlamassel herausgearbeitet hatte, erst am KBZ, später am Wilhelm-Gymnasium, und dass es jetzt vielleicht doch noch klappen würde mit der Versetzung.
Beim Abschied legte sie mir etwas in die Handfläche und drückte meine Finger darüber zusammen. Ich spürte etwas Glattes, Kaltes – es war einer der blauen Glassteine von der Fensterbank. „Ein Glücksstern“, sagte sie und schaute mir in die Augen, mit ihrem Intensiv-Blick.
Wieder mal dauerte es eine ganze Weile, ehe ich verstand: Sie spielte auf das bevorstehende Zeugnis an, wollte mir Glück wünschen. Und man merkte, dass sie das nicht nur so dahinsagte. Es war ihr wirklich wichtig. Sie wollte, dass ich die Versetzung noch schaffte, endlich in ruhiges Fahrwasser kam.







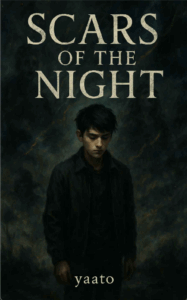

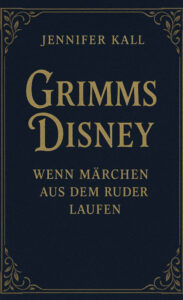

















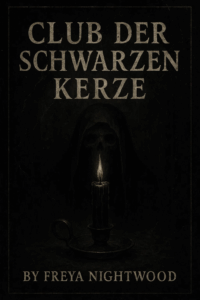


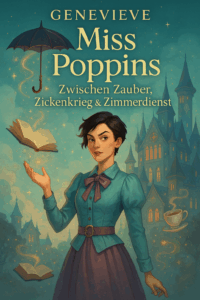







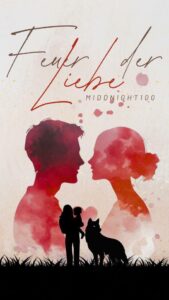

Kommentare