37. Kurparkfest


Ich stand auf der Außenplattform eines historischen Eisenbahnwaggons. In ruckeliger Fahrt ging es durch die Lande, vorbei an Feldern und Wiesen. Vorn schnaufte die alte Dampflok, manchmal zogen dunkle Rauchfetzen über uns hinweg. Trotz des gemächlichen Tempos zerwühlte mir der Fahrtwind ordentlich das Haar.
Das Sommerfest war in vollem Gange. Tatsächlich hatte die Museumseisenbahn zu diesem Anlass einen ihrer Dampfzüge entmottet, der nun stündlich zwischen Ort und Strand pendelte. Am Schönhagener Bahnhof hing sogar ein auf alt getrimmter Fahrplan. Die Angabe des Abfahrtgleises hätten sie sich allerdings sparen können – es gab bloß eins. Sönke, ein Mitstreiter aus dem Tombola-Team, lief in seiner Reichsbahner-Uniform durch die Waggons und lochte die Tickets. Ich durfte gratis mitfahren.
Auf der Grünen Insel war heute Flohmarkt. Die Mädchen hatten dort einen Stand, wollten alte Sachen verkloppen. Auf meine Frage, ob sich der Aufwand überhaupt lohne, hatte Kristina bloß geantwortet: „Da wirst du jeden Scheiß los und verdienst noch Geld damit.“
Abends stieg dann endlich unsere Tombola, im Kurpark am Ferienzentrum. Wir hatten tags zuvor die ersten Sachen aufgebaut, nachher sollte es weitergehen. Mein Rad stand noch im Park, ich war gestern abend gemeinsam mit Udo und den anderen im VW-Bus nach Schönhagen zurückgefahren.
Mit quietschenden Bremsen stoppte der Museumszug im Steenbarger Bahnhof. Die Freiwillige Feuerwehr hatte auf der Festwiese hinterm Bahnübergang eine Gulaschkanone aufgebaut, wer wollte, konnte sich hier mit Suppe und Würstchen verpflegen. Längst herrschte dichtes Gedränge – neben den Fahrgästen hatten sich auch viele Ausflügler eingefunden.
Immer wieder entdeckte man bekannte Gesichter in der Menge: Alex schaufelte emsig Eintopf in Plastiknäpfe, Micha legte Bockwürste dazu. Doris versorgte am Getränkestand durstige Kehlen mit Bier, Limo und Wasser. Jürgen lief herum und hatte alles im Blick. Er trug seine dunkelblaue Paradeuniform, trotz der gnadenlos brennenden Sonne. Als er mich sah, füllte er einen Plastikteller mit Suppe und hielt ihn mir hin: „Auf Kosten des Hauses.“ Schweiß perlte von seiner Stirn, die Locken klebten ihm an den Seiten und im Nacken. Ich hatte eigentlich null Hunger, mochte aber nicht nein sagen.
Während ich Eintopf löffelte, fauchte und zischte am Bahnsteig die Dampflok geduldig vor sich hin. Dann stieß sie plötzlich ein schrilles Pfeifen aus – das Signal zur Weiterfahrt. „Danke fürs Essen“, rief ich Jürgen zu, stopfte den leeren Teller in einen Müllsack und lief zum Zug. Drinnen war es jetzt längst nicht mehr so voll wie vorhin. Ich überlegte, mich hinzusetzen, blieb dann aber doch auf der Plattform – der Fahrtwind sorgte für wenigstens für etwas Abkühlung. In meinen Eingeweiden rumpelte und rumorte es vom Eintopf.
Bald fuhren wir in den Wald ein. Dichtes Laub verschluckte das Sonnenlicht, es wurde dämmrig und erstaunlich frisch, fast kalt. Ich fröstelte – wegen des Temperatursturzes, aber auch, weil ich plötzlich wieder daran denken musste, was für heute Nacht geplant war.
Nach der Tombola wollten wir im Geisterhaus eine Party feiern, eine Gruselparty. Die Idee war neulich am Strand entstanden. Kristina hatte angeregt, mal im Dunkeln zu dem Haus zu fahren. Nach anfänglichem Schaudern war die Stimmung allmählich umgeschlagen. Warum nicht Proviant mitnehmen und ein bisschen dort bleiben, überlegte Heiner. Bei ihm zu Hause im Keller liege noch ein Stapel alter Matratzen, erklärte Jürgen, die würden sich ideal zum Feiern eignen. Bernd wollte im Terrassenzimmer den Kamin anheizen. Schließlich brachte Maren den Abend der Tombola ins Spiel, wenn eh alle unterwegs waren. Dann müsse man sich nicht heimlich aus dem Haus schleichen, meinte sie.
Sofort wurde mit der Organisation losgelegt. Bernd stibitzte aus dem elterlichen Garten eine ordentliche Ladung Holzkloben für den Kamin. Heiner lieh sich von einem Kumpel eine Zündapp Bergsteiger mitsamt Anhänger, um damit Matratzen und Feuerholz zu transportieren. Wenn ein Vehikel den Holperweg durch den Wald schaffe, dann dieses, versicherte er. Tatsächlich ging die Aktion wohl ohne größere Probleme über die Bühne. Ein Teil der Matratzen wurde ins Terrassenzimmer gebracht, der Rest in den benachbarten Räumen ausgelegt, für später nach der Party.
So berichteten es die anderen. Ich selbst fuhr nie mit, half lieber Jürgen, die Matratzen bei ihm aus dem Keller bis zur Straße zu schleppen – immerhin 150 Meter Weg pro Ladung, weil der Hauseingang so weit zurückgesetzt lag. Auch wenn ich es nicht laut aussprechen mochte: Der Gedanke, das Geisterhaus noch mal zu betreten, jagte mir Angst ein. Obwohl mein Erlebnis an der Kellertreppe inzwischen schon eine ganze Weile her war.
Erst hatte ich den anderen das Party-Projekt ausreden wollen. Aber mit welcher Begründung? Weil’s im Geisterhaus spukte? Weil dort irgendwas in den Katakomben war, das Pfeiftöne von sich gab und eisige Kälte verbreitete? Das hätte ein schönes Gelächter gegeben! Und überhaupt – glaubte ich neuerdings an Gespenster? Was sollte passieren? Es würde spannend und lustig werden, Punkt.
Bernd wollte seine Karre heute stehenlassen und ebenfalls per Fahrrad in den Kurpark kommen. Der Plan war, dass wir uns gleich nach dem Ende der Tombola vom Acker machten, in Schönhagen unsere Schlafsäcke holten und dann die anderen trafen, an derselben Stelle wie neulich, bei unserem nächtlichen Badeausflug.
Der Wald endete, das Gleis verzweigte sich. Unser Zug drosselte das Tempo, es ging jetzt rumpelnd übers Gelände der Museumseisenbahn, vorbei an langen Reihen alter Eisenbahnwaggons, Lokomotiven, Straßenbahnen. Überall blätterte die Lackierung von den Fahrzeugen ab, viele Fenster waren eingeschlagen. Sönke betonte ständig, wie sehr er und die anderen Eisenbahnfreunde sich abmühten, alles instand zu halten, aber der Anblick war doch trostlos, ließ an einen Friedhof für Züge denken.
Wir hielten neben dem historischen Bahnhofsgebäude – Endstation. „Schönhagener Strand“, verkündete das Stationsschild in Frakturschrift. Eine knarzende Lautsprecherstimme lud zum Besuch des Eisenbahnmuseums ein. „Bis später, im Kurpark!“, hörte ich Sönke rufen. Ich winkte ihm zu und folgte den Massen, die sich Richtung Ausgang wälzten. Direkt neben mir ließ die Lokomotive zischend eine Dampfwolke ab, die sich schnell ausbreitete. Auf einmal war es wie im November: grau, neblig, trostlos. Die Bäume hinten am Wanderweg, nur noch schemenhaft zu erkennen, wirkten plötzlich wie abgestorben… aber der Spuk dauerte nur kurz: Draußen brannte die Sonne herab wie vorher, keine Spur mehr von herbstlicher Tristesse.
Bis zum Strand war es nicht weit. Auf der Promenade begann eine Budengasse, die völlig überfüllt war. Die Leute drängelten und schoben, immer wieder wurde man zwischen den schwitzenden Leibern eingequetscht. Hinter dem Ort war es nicht mehr ganz so eng, dafür fehlten jetzt Häuser, die Schatten spenden konnten. Alles lag im prallen Sonnenschein, mir klebten im Nu sämtliche Klamotten auf der Haut.
Am Mittelstrand lief der Parkplatz hinterm Deich schier über, hier ging gar nichts mehr. Die einzigen Fahrzeuge, die sich noch bewegten, waren die blinkenden Wagen eines Autoskooters, der neben Kiosk und Strandcafé aufgebaut war. Die Schlange an der Kasse vermischte sich mit dem Menschenstrom auf dem Weg, was zu einem heillosen Durcheinander führte. Beim Anblick all der Massen konnte man sich nur schwer vorstellen, wie ausgestorben es hier an Ostern gewesen war, auf der Radtour mit Muttern und Henri.
Als die Buden und Verkaufsstände aufhörten, ging ich auf der Deichkrone weiter. Selbst hier oben regte sich kaum ein Lüftchen. Spaziergänger begegneten mir jetzt nur noch selten, auf einmal wurde es sehr still. Unten am Strand sah man die Badegäste reglos in der Sonne braten, die See leuchtete fahl und bleigrau. Müde kamen die Wellen heran und schwappten mit letzter Kraft auf den Sand.
Wie anders dagegen das Bild auf der Landseite, wo sich inzwischen die Salzwiesen breiteten, frisch, üppig grün und voller Leben: Vögel schwirrten dort in dichten Pulks herum, Enten quakten, Grillen zirpten. Das heiße, knochentrockene Wetter, das wir derzeit hatten, schien den Wiesen kaum etwas auszumachen. Wie zum Gruß schickten sie nun einen angenehm kühlen Windzug zu mir herüber.
Leider endeten sie viel zu rasch. Oder vielmehr: Sie wurden brutal abgeschnitten durch monotonen, brettebenen Rasen – der Kurpark. Sein Anblick erinnerte verdammt an die Nordstadt: Plattenwege wie mit dem Lineal gezogen, mickrige Bäumchen, die sich mit letzter Kraft und der Hilfe von Stützbalken aufrecht hielten, Sonnendächer aus Beton. Spaziergänger sah man nirgends; lediglich ein paar Kaninchen hoppelten träge über den verbrannten Rasen. Am Horizont flimmerte das Ferienzentrum in Dunst und Hitze. Luftspiegelungen trennten die Türme vom Boden ab, ließen sie ein bisschen wie Raketen aussehen, die gerade gezündet hatten. Jeden Moment würden sie abheben und in den Himmel aufsteigen…
Ich hatte noch ein gutes Stück über die Rasenfläche zu laufen, ehe das Festareal begann. Hier gab es, neben den obligatorischen Buden und Karussells, auch einige Bühnen, auf denen sogar schon Bands spielten. Publikum war allerdings noch keins da – verständlich bei der Gluthitze. Am Tombola-Stand hatten die anderen bereits wieder losgelegt. Eine mit schwarzer Folie überdeckte Holzpyramide erhob sich inzwischen unter dem Partyzelt, das wir gestern aufgebaut hatten. Udo war mit dem VW-Bus auf den Rasen gefahren und reichte die Gewinne aus der Seitentür heraus. Ich wurde Bernd zugeteilt, sollte mit einem dicken Edding Nummern auf Pappschilder schreiben, die er an die Sachen heftete. Dann übernahmen Alex und Micha, drapierten alles auf der Pyramide. Das Ganze sah schon sehr ansprechend aus – wirklich krass, wie viel Zeugs wir zusammengeschnorrt hatten.
Der Hauptpreis war ein Sportrad. „Vom Großmarkt in Hoheneck. Euer Einsatz.“ Udo nickte uns anerkennend zu.
„Hatten eigentlich mit ’nem Auto gerechnet“, meinte Bernd. Die Enttäuschung war ihm deutlich anzuhören.
„Nun lasst mal die Kirche im Dorf“, lachte Udo.
Als alles fertig war, schwärmten wir mit Loseimern aus. Der Kurpark hatte sich mittlerweile gefüllt. Überall sah ich unsere Schilder hängen: „Große Tombola! Spannende Preise! Unterstützen auch Sie die Jugendarbeit in der Schönhagener Region!“ Die Werbung tat anscheinend ihre Wirkung: Ich verkaufte Lose wie blöd.
Muttern und Klaus kamen mir entgegen. „Da habt ihr wirklich gute Arbeit geleistet, Hauke“, meinte er und wies mit dem Daumen zum Tombola-Stand.
Meine Freude, die beiden zu sehen, hielt sich arg in Grenzen. Vor auf allem auf Klaus konnte ich gerade gut verzichten. Mir stieß einfach sauer auf, dass er so gar keine Hilfe war, wenn es um unseren Vater ging. In der Situation mit den Fotoalben zum Beispiel hatte er mich total im Regen stehen lassen.
„Krieg ich kein Los, Hauke?“, unterbrach seine Stimme meine Gedanken. Ich hielt ihm den Eimer zum Ziehen hin.
„Für dich auch?“, fragte er Muttern. Sie schwieg, aber ihre Antwort kannte ich jetzt schon…
„Ihr wisst doch, dass ich bei solchen Sachen nicht mitmache.“ Ihre Stimme klang gepresst, man spürte die Ablehnung wie eine Wand. Seit jeher hasste sie Lotterien, Glücksspiele und dergleichen wie die Pest. Aber konnte sie nicht mal über ihren Schatten springen, wenigstens heute?
Klaus guckte zwischen uns hin und her. Er schien etwas sagen zu wollen und sich nicht zu trauen. Wahrscheinlich hatte er wieder Schiss vor Muttern. Verflucht – bis vor kurzem war er derjenige gewesen, der bei uns die Richtung vorgab, und jetzt machte er sich andauernd klein, duckte sich weg. Was hatte ihm bloß den Mut genommen? Der Ärger mit seiner Ex? Die Befürchtung, dass er seine Kinder vielleicht nicht mehr sehen durfte? Konnten einen solche Sachen derart zermürben, dass man irgendwann alles Selbstvertrauen verlor?
Oder hatte ich mich einfach in ihm getäuscht? War er auch bloß einer dieser Schwächlinge, die sich vom kleinsten Problem umhauen ließen? Umgehauen, ausgeknockt – genauso wirkte er. Er lag am Boden, und irgendwas sagte mir, dass er nicht wieder aufstehen würde. Auf ihn konnte ich nicht mehr zählen…
Plötzlich wollte ich die beiden, wollte ich am liebsten niemanden mehr sehen. Ich nahm das Geld von Klaus für sein Los und ging weg, ohne noch mal zurückzuschauen.
Marens Eltern schlenderten händchenhaltend durch die Menge – genau in meine Richtung! Schnell drehte ich bei, versuchte in einer größeren Menschenansammlung unterzutauchen, aber zu spät: Sie hatten mich schon entdeckt. Ich machte halt, ergab mich meinem Schicksal.
„Hallo Hauke“, grüßte Frau Sühring mit ihrer freundlichen, warmen Stimme. Marens Vater nickte mir zu. Beide kauften ein Los.
„Das war ja neulich ’n doller Vortrag von dir“, meinte Herr Sühring. „Und – Spende genehmigt?“
„Klar!“, beeilte ich mich zu sagen. Ich merkte, wie ich knallrot wurde.
„Was willst du später eigentlich mal machen?“, fragte er unvermittelt. „Beruflich, meine ich? Was hast du für Ziele?“
Oje, daran hatte ich noch nicht den Funken eines Gedankens verschwendet. Später – wann sollte das sein? Ich lebte hier und jetzt. Wer konnte sagen, ob die Welt morgen überhaupt noch existierte? Wieder hatte ich das Gefühl, in einer Prüfung zu sein, wie schon im Hohenecker Großmarkt. Heute würde ich es vermasseln, das war sicher. Mir ging die Muffe, aber total.
„Du solltest überlegen, Betriebswirtschaft zu studieren“, fuhr er fort.
Betriebswirtschaft… Ich musste an Köpke in der Nordstadt denken, der immer meinte, Betriebswirte seien diese Schweine, die überall Leute feuern, aber selbst im dicken Porsche durch die Gegend fahren. Und so was sollte ich werden?
„Ich denk drüber nach“, murmelte ich.
„Maren will ja Jura studieren.“ Er ließ nicht locker.
So, wollte sie das? Davon wusste ich nichts. Allerdings hatten wir bisher nie über solche Themen gesprochen. Maren, eine Rechtsanwältin – bei diesem Gedanken kam sie mir plötzlich wieder sehr fremd vor.
„Unsinn, Hermann“, schaltete sich Marens Mutter ein. „Du willst, dass sie Jura studiert. Nun lass sie erst mal in Ruhe ihr Abitur machen, dann sehen wir weiter.“
Herr Sühring fing an zu grinsen. Die Vertraulichkeit zwischen den beiden wurde mir unangenehm. „Äh, ich muss mal weiter“, stotterte ich. „Noch ’n schönes Fest.“ Rasch drehte ich mich um und zog von dannen.
„Und euch noch viel Erfolg bei der Tombola!“, rief Herr Sühring mir hinterher. Ich tat, als würde ich ihn nicht mehr hören.
Meine Güte, was fehlte mir bloß? Konnte ich nicht einfach mal den Abend genießen, stolz darauf sein, dass wir die Tombola so gut hingekriegt hatten? Was war auf einmal anders geworden? Weshalb wollte ich von Klaus, dass er die ganzen alten Storys aus Muttern rausschüttelte, die komplette Sammlung? Was sollte das bringen? Die Zeit ließ sich damit auch nicht zurückdrehen. Dann diese Traurigkeit, die nun ständig alles überlagerte, dieses Gefühl, komplett allein zu sein, verlassen, abgeschnitten von allem – es wurde immer mehr stärker. Dagegen wirkte die Euphorie der vergangenen Monate auf einmal hohl, nur noch wie eine Illusion, eine Fata Morgana am Horizont, flimmernd, zitternd – und vielleicht bald verschwunden…
Henri war mit zwei seiner Kumpels unterwegs und versuchte, ein Gratislos rauszuschlagen. Vor einer Stunde hätte ich mich wohl noch erweichen lassen, aber jetzt biss er bei mir auf Stahlbeton: „Ohne Kohle läuft gar nix.“ Ich wusste um sein Glück bei Lotterien: Ob auf dem Jahrmarkt in der Nordstadt oder dem Hafenfest – irgendwas hatte der Kerl bisher immer gewonnen. Der brachte es fertig und heimste den Hauptgewinn ein, ohne bezahlt zu haben. Als er nicht lockerließ, wurde ich immer gereizter, hätte ihm beinahe eine gezwiebelt, wie früher, als er oft Blitzableiter für meine Wut gewesen war. Endlich gab er es auf und verdrückte sich, seine beiden Schergen im Schlepptau.
Die Verlosung begann. An unserem Stand flammte grelles Scheinwerferlicht auf. Udo machte den Zeremonienmeister, Bernd und Micha reichten ihm die Preise von der Pyramide herab. Ich stand nur dumm an der Seite und kam mir vor den ganzen Zuschauern hilflos und bescheuert vor.
Muttern und Klaus waren im Publikum, ein Stück hinter ihnen stand Henri. Auch Marens Eltern entdeckte ich, Herr Sühring schien mir einmal zuzuzwinkern. Ausgerechnet diese Geste löste einen neuen Schub Traurigkeit bei mir aus. Die ganze Situation fühlte sich plötzlich wie ein Abschied an. Es galt, Lebewohl zu sagen, ich musste mich trennen von dem Schönen und Leichten, das die letzten Monate geprägt hatte. Es war halt zu schön und leicht gewesen, um wirklich wahr zu sein, ich hatte es die ganze Zeit geahnt. Gute Dinge blieben nicht. Immer wenn man gerade anfing zu vertrauen, wenn man endlich alles genießen konnte, kam der Schnitt, das unsanfte Erwachen. Wieder allein, wieder Einzelkämpfer – so hieß die bittere Realität. Etwas war trotzdem anders als bisher: In der Nordstadt hatte man seine Dicke-Hose-Fassade gehabt, jetzt stand ich schutzlos da…






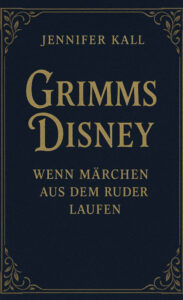


















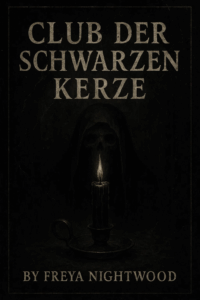













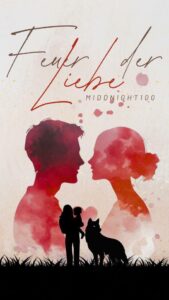



Kommentare