Kapitel 1: Leora

„Sie haben Krebs.“
Diese Worte hallten in meinem Kopf wider, laut, schrill, wie ein Echo, das nicht verklingen wollte. Ich sah den Arzt an, aber es fühlte sich an, als wäre er meilenweit entfernt. Mein Atem wurde flach, mein Brustkorb eng, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen und ich würde in einen bodenlosen Abgrund stürzen. Das konnte nicht sein. Das durfte einfach nicht wahr sein!
Ein eisiger Schauer lief mir den Rücken hinunterund panisch sprang ich auf. Der Stuhl kippte mit einem dumpfen Knall um, das Geräusch schien durch den Raum zu hallen, aber es klang seltsam gedämpft, unwirklich. Mir war es egal.
Alles verschwamm vor meinen Augen, als ich mir mit zitternden Fingern durch mein dunkles Haar fuhr. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen, mein Herz schlug zu schnell, zu hart. Ein Gefühl der Ohnmacht überkam mich, ein verzweifelter Fluchtinstinkt regte sich in mir – ich musste hier raus. Weit weg von diesem Raum, von dieser schrecklichen Realität.
Doch bevor ich mich bewegen konnte, legte sich eine vertraute Hand auf meine Schulter. Warm, sanft, aber bestimmt. Sie hielt mich zurück, verankerte mich, als würde sie mich davor bewahren, völlig den Halt zu verlieren.
Ich schluckte, ließ mich langsam zurück auf den Stuhl sinken, den jemand hastig wieder aufgerichtet hatte.
„Es ist schon okay, Leora, wir bekommen das hin,“ versuchte meine Mum mich aufzumuntern, doch auch ihre Stimme zitterte leicht. Normalerweise hatte sie die Kraft, mich mit ihrem ruhigen Ton zu beruhigen. Doch heute, in diesem Augenblick, klang sie selbst besorgt.
Ein Stich der Angst durchfuhr mich. Sie klang nicht wie jemand, der wusste, dass alles gut werden würde. Sie klang wie jemand, der sich verzweifelt wünschte, dass es so wäre.
Es ging nicht um ein kleines Problem. Nicht um eine vorübergehende Sorge.
Es ging um Krebs.
„Nein, Mum! Es ist nicht alles in Ordnung!“ brüllte ich fastund die Worte kamen mit einer Wucht aus mir heraus, die ich nicht kontrollieren konnte. Die ersten Tränen drangen unaufhaltsam aus meinen Augen und liefen heiß über meine Wangen.
„Verdammt, du hast Krebs! Wie kannst du so ruhig bleiben?“ meine Stimme Überschlug sich fast, während mein Herz raste und ich das Gefühl hatte, in einem Albtraum gefangen zu sein. Es war mir egal, dass der Arzt und die Krankenschwester immer noch im Raum waren. Ihre Blicke schienen mich nur noch mehr zu erdrücken.
„Lass uns erst einmal anhören, was der Arzt zu sagen hat, bevor wir panisch werden,“ sagte sie ruhig, doch in ihrer Stimme lag eine Spur von Anspannung, die ich nicht übersehen konnte. Sie nahm meine Hand in ihre, ihre Berührung war warm und beruhigend, ein Anker inmitten des emotionalen Sturms, der in mir tobte.
Mums sanftes Lächeln war wie ein Lichtstrahl in meiner Dunkelheit. Für einen flüchtigen Moment fühlte ich mich etwas ruhiger, auch wenn mein Inneres fast zu zerbersten drohte. Doch die Angst blieb hartnäckig, klammert sich an mein Herz wie eine lähmende Umarmung.
Ihre schokoladenbraunen Augen strahlten eine Wärme und Ruhe aus, die mir kaum die Chance ließ, nervös zu sein. Ich wollte glauben, dass alles gut werden würde, aber die Realität drückte schwer auf meiner Brust.
Mum nickte dem Arzt zu, der uns mit ruhigem, verständnisvollem Blick musterte. Anscheinend war er solche Reaktionen gewohnt. Vielleicht hatte er schon unzählige Male vor Menschen gesessen, deren Welt in einem einzigen Moment aus den Fugen geriet.
„Wir haben Glück, dass wir den Krebs früh entdeckt haben“, sagte er mit einer ruhigen, aber bestimmten Stimme. „Es gibt keine Anzeichen für Metastasen. Der Tumor wächst schnell, aber es besteht eine gute Chance, ihn zu bekämpfen. Allerdings sollten wir keine Zeit verlieren. Je früher wir mit der Therapie beginnen, desto besser.“ Er machte eine kurze Pause, bevor er mit sanfter Bestimmtheit hinzufügte: „Ihr malignes Karzinom scheint sehr aggressiv zu sein.“
Ich brauchte ein paar Sekunden, um die Worte zu verarbeiten. Ich verstand nicht jedes Wort. Doch ich wusste was es im Endeffekt hieß. Krebs. Diese unaussprechliche Realität hatte nun Einzug in unser Leben gehalten.
Als ich wieder zu Mum sah, erkannte ich nun doch eine Unruhe in ihren Augen – ein flüchtiges Funkeln der Angst, das sie verzweifelt zu verbergen versuchte. Jetzt war ich es, die ihre Hand drückte, in dem verzweifelten Versuch, ihr ein Lächeln zu schenken, doch mir gelang es nicht. Stattdessen fühlte ich, wie meine eigene Verzweiflung sich in ihre Hände übertrug, während ich versuchte, ihr zu zeigen, dass sie nicht alleine war.
Der Arzt räusperte sich sanft und fuhr fort: „Es ist gut, dass Sie hier sind. Ich habe einen engen Kollegen in einer spezialisierten Klinik, der Ihnen schnell einen Platz verschaffen könnte. So müssten Sie nicht lange auf den Beginn der Chemotherapie warten.“ Seine Stimme blieb sachlich, aber in ihr lag ein Hauch von echtem Mitgefühl.
Meine Mum nickte, während ihr kastanienbrauner Pony, der bereits einige graue Strähnen hatte, nervös auf und ab wippte.. „Ja … das wäre sehr hilfreich. Wann könnte die Therapie beginnen?“ Ihre Stimme klang fest, aber ich konnte spüren, wie die Anspannung in ihr wuchs.
„Mein Freund wird sich in den nächsten Wochen bei Ihnen melden. Aber es ist wichtig, dass wir nicht zu lange warten; sonst könnte der Krebs gefährlich werden und streuen,“ antwortete erund ich bemerkte, wie der ernste Tonfall der Worte in der Luft hing.
Mein Blick wanderte zur weißen Wand hinter dem Arzt, auf der ein gemaltes Bild einer glücklichen Familie hing. Die fröhlichen Gesichter und bunten Farben schienen im krassen Gegensatz zu unserer Realität zu stehen und zogen mich weiter in ein tiefes Loch der Verzweiflung. Warum musste uns so etwas immer passieren? Meine Mum und ich hatten schon lange kein Glück mehr gehabtund dieser Anblick von dem Bild verstärkte nur mein Gefühl der Ungerechtigkeit.
Der sterile Geruch von Krankenhaus und Desinfektionsmittel stieg mir in die Nase und ließ mir erneut bewusst werden, wo ich war. Der Drang, so schnell wie möglich aus diesem Raum zu fliehen, überkam mich ein weiteres mal, doch ich wusste, dass ich nicht einfach weglaufen konnte. Wir mussten durchhalten, kämpfen – für meine Mum und gegen diese verfluchte Krankheit.
„Wie viel kostet das Ganze?“ stellte ich mit rauer Stimme die Frage, die alles entscheiden würde. Die Worte kamen schwer über meine Lippen, während ich versuchte, die aufsteigende Panik zu kontrollieren.
Ich hatte gehört, dass Chemotherapien in den USA extrem teuer sein konnten und das, was der Arzt gerade gesagt hatte, klang alles andere als günstig. Dass er uns an eine Klinik empfehlen wollte, ließ mich noch mehr an der Höhe der Kosten zweifeln. Und auch das es schnell gehen musste.
Ich lebte mit meiner Mum in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung in einem armen Viertel. Unsere finanzielle Situation war angespannt, ich arbeitete in einem kleinen Café, während meine Mum als Vollzeit-Putzfrau arbeitete. Selbst mit all unseren Mühen reichte das Geld oft nur gerade so zum Leben.
„Die Behandlung kann bis zu 50.000 Dollar kosten“, sagte der Arzt vorsichtig. „Darin enthalten sind die Chemotherapie, die notwendigen Medikamente, die Krankenhausaufenthalte – und falls Komplikationen auftreten, könnten zusätzliche Eingriffe oder eine Operation nötig sein.“ Er machte eine kurze Pause, dann fügte er mit einem entschuldigenden Unterton hinzu: „Leider sind auch die Kosten für ärztliche Betreuung, Laboruntersuchungen und mögliche Nachsorgebehandlungen nicht zu unterschätzen. Ohne Versicherung kann das schnell sehr teuer werden.“
Geschockt hätte ich fast wieder aufstehen wollen. Fünfzigtausend Dollar?! Das hatten wir auf keinen Fall. Die Summe war so astronomisch, dass sie mir den Atem raubte. Wie sollten wir das je aufbringen?
„Es ist die einzige Möglichkeit, den Krebs einzudämmen und zu verhindern, dass Sie sterben. Es tut mir leid, das zu sagen, aber wenn Sie nicht in den nächsten Monaten mit der Chemotherapie beginnen, werden Sie das nächste Jahr sehr wahrscheinlich nicht mehr miterleben,“ erklärte er ernsthaft.
Seine Worte trafen mich wie ein Schlag ins Gesicht. Der Gedanke, dass meine Mum sterben könnte, war unerträglich. Ich fühlte, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildeteund der Schmerz schnürte mir die Brust zu. Ich musste unbedingt dafür sorgen, dass wir das Geld zusammenbekamen. Die Vorstellung, sie zu verlieren, war nicht nur beängstigend – sie war unvorstellbar.
In diesem Moment schwor ich mir, dass ich alles tun würde, um sie zu retten. Ich würde kämpfen, auch wenn das bedeutete, in die tiefsten Abgründe der Verzweiflung und des Zweifels hinabzusteigen. Es durfte nicht enden, bevor wir es nicht wenigstens versucht hatten.
Am Abend:
Auch wenn ich mir geschworen hatte, diese Nummer nie wieder zu wählen, tippte ich sie trotzdem ein. Meine Finger zögerten einen Moment über dem Anrufsymbol, als könnte ich damit die unausweichliche Realität aufhalten. Doch schließlich drückte ich es.
Ein unangenehmes Kribbeln breitete sich in meinem Bauch aus, eine Mischung aus Nervosität und Wut. Mein Blick wanderte durch mein kleines, chaotisches Zimmer – als könnte ich dort irgendetwas finden, das mich ablenken würde. Kleidung lag zerknüllt auf dem Boden, mein Schreibtisch war vollgestapelt mit alten Notizen, leeren Kaffeetassen und halb aufgeklappten Büchern, die ich in den letzten Tagen nicht einmal richtig gelesen hatte. Ein einziges Durcheinander. Genau wie ich. Meine geliebten Pflanzen hatte ich auch vergessen zu gießen.
Warum tat ich das?
Ich hasste es, um Hilfe zu bitten. Ich hasste das Gefühl, abhängig zu sein, jemandem etwas schuldig zu sein. Und ausgerechnet ihn darum zu bitten, war das Letzte, was ich wollte. Doch es ging nicht um mich. Es ging um Mum.
Mein Handy vibrierte leise in meiner Hand, während das Freizeichen gefühlt ewig ertönte. Vielleicht ging er gar nicht ran. Vielleicht war das hier eine dumme Idee gewesen. Vielleicht—
„Hallo? Wer ist da?“ kam es unsicher aus dem Lautsprecher meines Handys. Die Stimme die ich seit einem halben Jahr nicht mehr gehört hatte.
Mein Daumen zuckte kurz über dem roten Auflege-Button. Ich hätte einfach auflegen können. So tun, als wäre es ein Versehen gewesen. Ihn wieder aus meinem Leben streichen, bevor er auch nur eine Chance hatte, wieder Teil davon zu werden.
Aber das konnte ich nicht.
Es ging um Mum. Und für sie würde ich alles tun.
„Ich bin’s, Dad,“ meldete ich mich mit einer kühlen Stimme, versuchte, keine Emotionen herauszuhören. Er sollte nicht wissen, wie schwer es mir fiel, ihn überhaupt anzurufen.
„Leora?“ seine Stimme klang überrascht. „Bist du es wirklich? Ist bei dir und deiner Mum alles in Ordnung? Du hast dich echt schon lange nicht mehr gemeldet,“ fragte er.
Seine Worte klangen wie eine leere Floskel. Ich glaubte ihm kein Wort. Er machte sich nie Sorgen, das hatte er noch nie getan. Schließlich hatte er uns vor vier Jahren, als ich noch 19 war, einfach verlassen – ohne Geld, ohne einen Blick zurück, nur für eine blonde Tusse, die in London lebte. Wenigstens war er jetzt einen ganzen Ozean von uns entfernt.
„Ja, ich bin es. Deshalb rufe ich an. Mum geht es nicht gut, sie hat Krebs,“ platzte es aus mir herausund ich kam sofort auf den Punkt, da ich keine Sekunde länger mit ihm reden wollte. Früher hatte er immer versucht, sich mit mir zu treffen, hatte mich mehrfach angerufen, aber irgendwann hatte ich ihn blockiert. Es gab keinen Grund mehr, sich mit ihm zu beschäftigen.
„Krebs? Oh je, geht es ihr denn gut?“ fragte er und ich hörte eine Sorge in seiner Stimme, die mir fremd vorkam. Diese Art von Besorgnis hatte ich nie von ihm gekannt. Er konnte schon immer gut schauspielern, das hatte er auch getan, als er meine Mum Jahre lang betrogen hatte.
Ich spürte, wie sich die Wut in mir zusammenballte, während ich seine Worte verarbeitete. Diese verlogene Besorgnis – was wusste er schon von „gut“ oder „schlecht“? Mir wurde schwindelig bei dem Gedanken, dass ich ihm die Situation erklären musste. Was hatte er sich jemals um uns gekümmert? Die Enttäuschung drückte auf meine Brust wie ein schwerer Stein, doch ich musste stark bleiben.
„Momentan geht es ihr ganz in Ordnung, aber der Arzt meinte, wir sollten so früh wie möglich mit der Chemotherapie anfangen,“ seufzte ich. Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, als würde das Aussprechen der Worte die Realität noch unausweichlicher machen.
Ich hasste das. Ich hasste jede Sekunde dieses Gesprächs.
Meine Finger krallten sich in die alte, zerknitterte Bettdecke, als könnte ich mich an ihr festhalten. Mein ganzer Körper war angespannt, meine Brust eng, als hätte sich ein unsichtbares Band um sie gelegt.
Jetzt kam der schwierige Teil.
Ich wollte nicht fragen. Ich wollte es so verdammt nochmal nicht. Aber was blieb mir anderes übrig?
Ich schloss kurz die Augen, zwang mich zu einem tiefen Atemzug, als könnte ich mir dadurch einreden, dass es einfacher werden würde. Doch als ich wieder sprach, war meine Stimme härter, als ich es geplant hatte.
„Deshalb rufe ich dich an. Die Chemotherapie kostet 50.000 Dollar und du weißt, dass wir nicht das Geld dafür haben.“
In der Stille nach meinen Worten hörte ich im Hintergrund das Geschrei von Kindern, die anscheinend stritten. Seine neue Familie. Ich wusste, dass er sich ein neues Leben aufgebaut hatte, mit Kindern, die er wahrscheinlich mehr liebte als uns jemals. Aber ich wollte nicht wissen, wie viele es waren oder wie glücklich sie waren.
„Leora, du rufst mich nach all der Zeit endlich wieder an, nur um mich nach Geld zu bitten? Ich habe selber nicht so viel Geld, ich kann dir leider keins geben,“ antwortete er und ich hörte die genervte Unterton in seiner Stimme.
Diese genervte Art kannte ich nur zu gut von ihm. Früher hatte er fast nie gute Laune, wollte nichts unternehmen oder Zeit mit mir verbringen. Er war schon immer ein schlechter Vater gewesen. Ich erinnerte mich an die vielen Wochenenden, die ich alleine in meinem Zimmer verbracht hatte, während er mit seinen Freunden in die Stadt ging, bis spät in die Nacht.
Aber tief im Inneren wusste ich, dass er Geld hatte – das wussten wir beide. Schließlich arbeitete er in London für eine große Bank und verdiente dort Unmengen von Geld. Doch die Vorstellung, ihn um Hilfe zu bitten, war für mich erniedrigend. Es fühlte sich an, als würde ich vor einem Mann knien, der uns einmal im Stich gelassen hatte.
„Es geht nicht um mich! Es geht um Mum! Sie braucht diese Behandlung, sonst gewinnt der Krebs!“ rief ich, die Kontrolle über meine Stimme kaum noch haltend. Die Worte schossen aus mir heraus, als ich die Wut und Verzweiflung, die ich fühlte, nicht länger zurückhalten konnte.
„Wir wissen beide, dass du Geld hast. Ich bitte dich nicht, uns die gesamten 50.000 Dollar zu geben, nur ein bisschen! Wir würden es auch irgendwann zurückzahlen,“ flehte ich ihn fast an, meine Stimme zitterte, als ich mir bewusst wurde, wie verzweifelt ich klang.
Ich konnte nicht ruhig sitzen bleiben; das Bett fühlte sich an, als würde es mich erdrücken. Nervös ging ich ans Fenster und schaute in die Dunkelheit hinaus. Draußen liefen einige Leute an unserer kleinen Wohnung vorbei, andere standen einfach da und tranken Alkohol. Ihre Lieder und das Lachen drangen in meine Gedanken, als ob sie eine andere Welt lebten – eine, in der es keine Sorgen gab.
„Ich gebe euch kein Geld. Versuch es woanders,“ motzte er mich jetzt anund ich spürte, wie die Wut in mir aufstieg.
In all den Jahren hatte sich ein tiefer Hass gegenüber meinem sogenannten „Vater“ aufgebaut, der jetzt nur darauf wartete, herauszulangen. „Das ist ja das Problem! Ich kenne niemanden anderen, der uns das Geld leihen könnte! Sonst würde ich dich niemals anrufen. Denkst du denn nicht, dass du mir und meiner Mum etwas schuldest, nachdem du uns einfach für eine Schlampe verlassen hast?“
Die Worte sprudelten nur so aus mir heruas. Ich war mehr als nur in Fahrt. „Du hast uns mit all den Schulden allein gelassen! Hast nie einen Finger gerührt und dir dann einfach das Recht genommen, uns in diesem Drecksloch zurückzulassen. Deine eigene Tochter! Und jetzt, wo du ein neues Leben hast und auch viel Geld verdienst, möchtest du nicht einmal einen Finger rühren und uns ein bisschen Geld leihen! Obwohl wir wegen dir so viele Probleme und Schulden hatten. Du Mistkerl…“
Das letzte Wort hauchte ich nur noch ins Handy, als stumme Tränen über meine Wangen liefen. Ich wischte sie mir hastig weg, als würde ich damit die ganze Wut und Enttäuschung abwehren können. Meine Hände, in denen ich das Handy hielt, fingen an zu zittern, fast wäre es mir aus den Fingern gerutscht.
Ich wartete auf seine Antwort – auf ein Wort der Entschuldigung, eine Rechtfertigung oder zumindest eine Antwort, egal ob er mich anschrie oder sich entschuldigte. Doch das Einzige, was ich hörte, war ein piependes Geräusch. Er hatte aufgelegt.
Die Stille in meinem Zimmer fühlte sich wie ein schwerer Schleier an, der mich erstickte. Ich ließ mich auf mein Bett fallen, die Tränen flossen ungehindert und die Wut, die mich eben noch getragen hatte, wurde nun von einer erdrückenden Hilflosigkeit abgelöst. Was sollte ich jetzt nur tun?












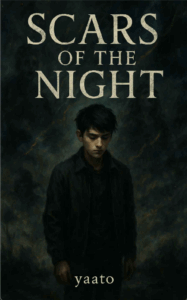









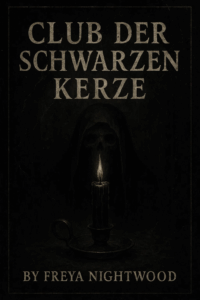

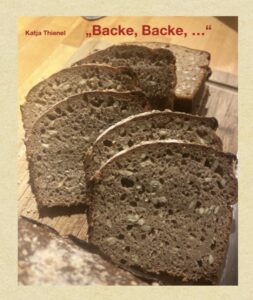













Kommentare