Kapitel 3: Leora

Zehn Tage später:
„Schatz, ich bin stolz auf dich, aber bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst?“ Mums Stimme klang sanft, aber ich hörte die Anspannung darin. Ihr Blick war auf die vorbeiziehende Landschaft gerichtet, doch ich wusste, dass ihre Gedanken ganz woanders waren. „Wenn du es dir anders überlegst, finden wir eine andere Lösung.“
Ich sah, wie sie nervös ihre Hände in den Schoß legte und versuchte, die Sorge in ihrem Blick zu verbergen. Auch ich wandte meinen Blick nach draußen, wo die Bäume wie in einem Fluss an uns vorbeizogen, als würde die Zeit selbst davonrennen. In der Ferne konnte ich bereits das Meer erahnen. Ein tiefes Blau, das sich mit dem Horizont vereinte.
„Ja, Mum, ich bin mir sicher.“ Ich versuchte, meine Stimme ruhig und überzeugt klingen zu lassen. „Es ist nur für einen Monat. Ich rufe dich jeden Abend an und wenn irgendwas ist, bin ich sofort zurück. Du bist nicht allein.“
Meine Worte klangen selbstbewusster, als ich mich fühlte, aber ich wollte, dass sie es glaubte. Ich wollte, dass sie wusste, dass ich alles unter Kontrolle hatte. Doch die Wahrheit war, dass mir das Herz schwer wurde bei dem Gedanken, sie in einer Zeit, in der sie mich so sehr brauchte, zurückzulassen.
Das Taxi rollte weiter und der Fahrer hatte sich die letzten dreißig Minuten nicht einmal geräuspert. Fast, als würde auch er spüren, dass die Luft in diesem Wagen von unausgesprochenen Gedanken erfüllt war. Wir hatten bereits zwei Stunden Zugfahrt hinter uns, die Küste lag weit entfernt von unserem Zuhause. Jetzt war das Meer direkt neben der Straße, das leise Rauschen der Wellen drang durch das leicht geöffnete Fenster.
Fünf Jahre war es her, seit ich das Meer zuletzt gesehen hatte. Damals war noch alles anders gewesen.
Bevor ich realisierte, dass die Fahrt zu Ende war, hielt der Taxifahrer auf einem kleinen Parkplatz. Meine Mum und ich stiegen aus. Es fühlte sich seltsam endgültig an, obwohl es nur ein Monat sein würde. Doch wir wussten beide, dass dieser Abschied sich anders anfühlte – als wäre er schwerer als all die Male zuvor. Es konnte ihr jederzeit etwas passieren.
Nachdem ich die Bewerbung abgeschickt hatte, bekam ich am nächsten Morgen direkt eine Nachricht, dass ich angenommen worden war. Alles ging so schnell und plötzlich war der heutige Tag gekommen. Ich hatte das Gefühl, keine Sekunde innegehalten zu haben, um wirklich zu begreifen, was das bedeutete.
Ich trat einen Schritt auf meine Mum zu und schloss sie fest in meine Arme. Sie drückte mich so fest an sich, als wolle sie mich nie wieder loslassen. Ihr vertrauter Duft von Blumenparfum erfüllte meine Sinne und für einen Moment vergaß ich die Angst, die tief in mir nagte. Ich wusste, dass es ihr genauso schwer fiel, mich loszulassen, aber sie sagte nichts. Vielleicht, weil sie wusste, dass es keinen anderen Weg gab.
Als ich sie wieder losließ, lächelten wir uns an. In dem Moment wurde mir wieder bewusst, wie wichtig sie mir war und dass es weh tat sie zu verlassen. Aber ich musste das tun, damit sie mich nicht für immer verließ.
„Hab eine gute Heimfahrt und ruf mich an, wenn was ist!“ rief ich noch schnell, bevor ich mich mit einem letzten Winken von meiner Mum verabschiedete.
„Pass auf dich auf“, hörte ich sie leise sagen, kurz bevor die Autotür zuschlug und der Klang des wegfahrenden Taxis sich in das Rauschen der Wellen mischte. Ich stand noch einen Moment da, ließ die kühle Meeresluft meine Haut streicheln und versuchte, meine Gedanken zu ordnen.
Dann begann ich, den Weg entlang des Meeres zu gehen, der mir auf meinem Handy angezeigt wurde. Die Sonne stand hoch am Himmel und tauchte alles in ein warmes, goldenes Licht.
Die Möwen kreisten über meinem Kopf und ihr Schreien hallte über das Wasser, während einige von ihnen neugierig nach Futter bettelten. Der salzige Geruch des Meeres stieg mir in die Nase, ein vertrauter Duft, den ich schon immer mit Freiheit und Ruhe verbunden hatte. Für einen Moment fühlte ich mich fast wie auf einem kleinen Abenteuer – doch die Nervosität lag wie ein Knoten in meinem Magen.
Ich prüfte noch einmal mein Handy, um sicherzugehen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Plötzlich zeigte das Display an, dass ich mein Ziel erreicht hätte. Verwirrt blickte ich auf und ließ meinen Blick schweifen. Weit und breit war kein Haus in Sicht. Nur das sanfte Schaukeln einiger kleiner Fischerboote, die auf den Wellen hin und her tanzten.
„Was zur Hölle?“ murmelte ich leise und drehte mich im Kreis, um nach irgendeinem Hinweis zu suchen. Kein Haus, keine Straße – nur ich und das endlose Meer. Hatte ich mich verlaufen? Oder war ich tatsächlich auf eine dieser dubiosen Internetanzeigen reingefallen?
In der Ferne entdeckte ich einen Mann. Er schien Mitte fünfzig zu sein, mit dunkler Haut und bereitete gerade sein kleines Fischerboot für die Abfahrt vor. Sein Haar wehte leicht im Wind und sein Gesicht wirkte freundlich, fast einladend. Das Boot schaukelte sanft auf den Wellen und die Holzplanken knarrten bei jeder Bewegung des Wassers.
Da weit und breit niemand anderes zu sehen war, fasste ich mir ein Herz und begann, den kleinen Hügel hinunterzugehen, der mich zu ihm führte. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont zu und blendete mich so sehr, dass ich eine Hand schützend vor meine Augen halten musste, während ich mich vorsichtig vorwärts tastete. Der Wind wurde etwas stärker und ich konnte das sanfte Zischen der Wellen hören, die gegen den Strand schlugen.
Als ich schließlich unten ankam und direkt vor seinem Boot stand, drehte er sich um, ohne dass ich ihn ansprechen musste. Ein warmes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als hätte er bereits geahnt, dass ich kommen würde.
„Hallo, du musst Leora sein. Habe ich recht?“ fragte der Mann mit einem freundlichen Lächeln, das mir im ersten Moment unheimlich vorkam. Verwirrt starrte ich ihn an, mein Herz schlug schneller. Woher kannte er meinen Namen? Ich war mir sicher, ihn nie zuvor gesehen zu haben.
„Woher kennen Sie meinen Namen?“ fragte ich misstrauisch und ließ meinen Blick für einen Moment über das alte Holzboot gleiten, auf das er mich wortlos hinaufwinken wollte.
„Wir können das alles auf der Fahrt klären. Aber wir sollten langsam los, die Sonne wird bald untergehen.“ Sein Ton war freundlich, aber bestimmt. Ich zögerte, doch die Zeit drängte – und irgendwie strahlte er eine gewisse Sicherheit aus, auch wenn der Gedanke, mit einem Fremden auf ein Boot zu steigen, mir nicht behagte. Vor allem hatte er nicht geantwortet, woher er mein Name kannte. Nach kurzem Überlegen tat ich, was er sagte und kletterte auf das schaukelnde Boot.
Die ganze Situation fühlte sich seltsam an. Hatte er etwas mit der Stellenanzeige zu tun? Oder war das alles nur ein verrückter Zufall? Was, wenn er mich entführen wollte? Diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, aber gleichzeitig: Warum sollte er dann so freundlich sein? Und er wirkte überhaupt nicht wie jemand, der anderen schaden wollte.
„Wissen Sie zufällig, wo diese Adresse ist?“ fragte ich stattdessen und zeigte ihm mein Handy mit dem Standort, den ich erreichen sollte. Der Mann kniff seine Augen leicht zusammen, um den Bildschirm besser sehen zu können und ich merkte, wie alt er eigentlich war – die kleinen Fältchen, die sich um seine Augen gebildet hatten und die grauen Strähnen, die im Wind wehten. Ein breites Grinsen legte sich auf sein Gesicht, als er wieder zu mir aufschaute.
„Die Adresse auf deinem Handy ist genau hier. Du bist richtig.“
„Wie bitte?“ Verwirrung breitete sich in mir aus. „Das kann nicht sein. Ich soll doch zu einem Haus, in dem ich dann ein Monat leben werde. Aber hier ist weit und breit nur Meer“, protestierte ich und zog meine Augenbrauen zusammen, als die Unsicherheit sich in mir festsetzte.
Doch der Mann lachte einfach. Sein Lachen war tief und herzlich, als hätte ich etwas Unglaublich Witziges gesagt. Das verwirrte mich nur noch mehr.
„Mir wurde gesagt, dass ich heute eine junge Dame mit zu der Insel bringen soll“, erklärte er, nachdem er sich beruhigt hatte. „Und das bist offensichtlich du. Das Haus, das du suchst, liegt auf einer Insel. Es ist nur mit einem Boot oder Helikopter erreichbar.“
„Eine Insel?“, wiederholte ich, fast wie in Trance, während ich versuchte, den Gedanken zu verarbeiten. Plötzlich fügte sich alles zusammen – na ja, fast. Es war so offensichtlich und doch hatte ich es übersehen. Natürlich hätte ich, bevor ich hierherkam, erst einmal recherchieren können, wo genau alles lag. Aber in meiner Panik und Verzweiflung hatte ich das Wichtigste übersehen. Typisch. Einfach darauf loszugehen, ohne genauer nachzudenken – so naiv, wie ich eben war.
Der Gedanke, einen Monat auf einer Insel zu verbringen, klang auf den ersten Blick sogar verlockend. Aber je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wuchs ein beklemmendes Gefühl in mir. Ich wusste, dass ich mich schnell eingesperrt fühlen würde. Allein auf einer Insel, abgeschnitten von der Welt? Ich konnte nur hoffen, dass es sich um eine größere Insel handelte, mit genug Platz, um nicht das Gefühl zu haben, eingeschlossen zu sein.
„Aber jetzt komm, hilf mir noch schnell mit dem Aufladen. Wir sollten bald los“, sagte der Mann plötzlich, etwas gestresster. Er deutete auf ein paar Kisten und meinen Koffer, die noch am Rand standen und auf das Boot geladen werden mussten.
Ich riss mich aus meinen Gedanken und nickte, während ich zu den Kisten ging. Der salzige Geruch des Meeres mischte sich mit der frischen Brise und das Rauschen der Wellen beruhigte mich ein wenig. Auch wenn alles seltsam und unsicher war, musste ich das jetzt durchziehen. Es war meine Chance, das Geld für die Behandlung meiner Mutter zu verdienen.
Wir waren nach nur wenigen Minuten mit dem Aufladen fertig und Tom, so war sein Name, fuhr langsam vom Festland weg. Ich setzte mich auf die hölzerne Bank des Bootes und beobachtete, wie die kleinen Wellen sanft gegen den Rumpf schlugen. Alles an diesem Moment hatte etwas von einem Urlaub – zumindest für einen Augenblick.
Ich sah zurück auf das Festland, das langsam immer kleiner wurde, bis es schließlich nur noch ein unscharfer Streifen am Horizont war und dann ganz verschwand. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in mir aus, während ich mich fragte, ob es wirklich die richtige Entscheidung gewesen war, diese Stellenanzeige anzunehmen und meine Mum für einen ganzen Monat alleine zu lassen. Der Wind spielte mit meinen Haaren und ich spürte, wie die Ungewissheit mich ergriff.
„Dir hat wirklich niemand gesagt, dass du auf eine Insel musst?“ riss mich Tom aus meinen Gedanken. Seine Stimme war freundlich, aber neugierig, als er das Boot durch die sanften Wellen steuerte.
„Nein“, antwortete ich etwas zögerlich. „Ist die Insel denn weit weg vom Festland?“
Er grinste schief und zuckte mit den Schultern. „Kommt darauf an, was du unter weit verstehst. Wir sind etwa zwanzig bis dreißig Minuten mit diesem Boot unterwegs, bis wir ankommen. Also, schwimmen würde ich die Strecke nicht empfehlen.“
Er lachte über seinen eigenen Witz und obwohl ich innerlich angespannt war, musste ich ebenfalls schmunzeln. Tom wirkte sympathisch, was die Situation etwas erträglicher machte. Doch meine Nervosität war damit noch lange nicht verflogen.
„Und wie viele Menschen leben auf dieser Insel?“ fragte ich neugierig, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch mehr Gesellschaft gab, als ich bisher vermutet hatte.
Sein Lachen verstummte abrupt und er sah mich jetzt ernst an. „Ich weiß nicht, ob dir die Antwort gefallen wird. Für manche wäre es ein Traum, für andere ein Albtraum. Auf der Insel steht nur ein Haus. Da wohnen nur die Millers, also die Familie und der kranke Neffe, den du pflegen wirst. Sonst ist die Insel komplett verlassen.“
Ich starrte ihn entsetzt an. Das konnte doch nicht wahr sein. Alleine, nur mit einem kranken Menschen, auf einer verlassenen Insel? Mein schlechtes Bauchgefühl verstärkte sich. Was wenn der Neffe kaum kommunizieren konnte? Was, wenn er schwer krank war? Was sollte ich dann den ganzen Tag tun? Unzählige Fragen schwirrten mir durch den Kopf und die Leichtigkeit, die ich noch vor wenigen Minuten gespürt hatte, wich einer wachsenden Panik.
„Keine Angst, ich komme jeden Dienstag vorbei, solange das Wetter mitspielt und schaue, ob alles in Ordnung ist. Ich bringe dann auch Essen und andere Dinge mit, weil die Millers-Familie die Insel normalerweise fast nie verlässt“, sagte er in einem beruhigenden Ton. Doch für mich klang es alles andere als beruhigend. Wer würde freiwillig auf einer einsamen Insel leben, völlig abgeschottet von der Außenwelt? War da vielleicht etwas, das sie versteckten?
„Warum verlassen sie die Insel dann ausgerechnet jetzt für einen ganzen Monat, wenn sie sonst nie weggehen?“ fragte ich, die Neugier in meiner Stimme nicht verbergend.
„Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich bringe ihnen nur das Nötige vorbei. Aber du wirst schon sehen – die Familie wirkt vielleicht ein wenig… eigenartig. Aber sie sind eigentlich ganz nett“, sagte er und zuckte mit den Schultern, als wäre es das Normalste der Welt, für Menschen einzukaufen, die auf einer Insel in völliger Isolation lebten.
Während wir über das glitzernde Wasser fuhren, erzählte er mir Geschichten aus seinem Leben. Er sprach von seinen Enkelkindern, wie sehr er das Meer liebe und dass er durch das Fischen und Erledigungen für die Leute in der Umgebung seinen Lebensunterhalt verdiente.
Nach einer Weile konnte ich in der Ferne einen dunklen Berg aus dem Wasser ragen sehen, wie er majestätisch durch die glatte Oberfläche des Meeres brach. Je näher wir kamen, desto deutlicher konnte ich die Insel erkennen. Der Berg, der anfangs so hoch gewirkt hatte, erschien jetzt viel kleiner, eher wie ein Hügel. Die Küste war auf unserer Seite rau und steinig, mit schroffen Klippen, die sich mehrere Meter über das Wasser erhoben. Es war offensichtlich, dass wir hier keinen Zugang zur Insel finden würden.
Tom lenkte das Boot gekonnt in einer sanften Kurve um die Insel herum. Plötzlich änderte sich die Landschaft vor meinen Augen. Dichtes Grün schien sich vor uns auszubreiten, Bäume reckten sich in den Himmel und dann sah ich ihn – einen Wasserfall, der von den Klippen herab ins Meer stürzte.
Ich konnte nicht anders, als in Ehrfurcht zu starren. Die Insel war weit schöner, als ich es mir je hätte vorstellen können. Die Mischung aus wilder Natur und dem sanften, klaren Blau des Meeres hatte etwas Magisches. Vielleicht würde dieser Monat doch nicht so schlimm werden, wie ich anfangs befürchtet hatte.
Langsam fuhren wir um die Insel herum und erst jetzt fiel mir auf, dass sie viel größer war, als ich zunächst gedacht hatte. Die dichten Wälder, die sich über die sanften Hügel erstreckten, schienen endlos zu sein. Irgendwann entdeckte ich das Dach eines riesigen Hauses, das sich nur schemenhaft zwischen den Baumwipfeln abzeichnete. Die blendende Sonne hinderte mich daran, mehr Details zu erkennen, aber allein der Anblick ließ mein Herz schneller schlagen. Es wirkte beeindruckend und ein wenig einschüchternd.
Bald verschwanden die schroffen Klippen, die uns bisher begleitet hatten und machten weichem, goldenen Sand Platz. Das Meer plätscherte sanft gegen den Uferbereich, der so ruhig und einladend wirkte, dass ich am liebsten sofort hineingesprungen wäre.
Tom steuerte das Boot auf einen kleinen, schmalen Steg zu, der sich in die Wellen erstreckte und anscheinend der einzige Zugang zur Insel war.
Das war also die Insel, auf der ich die nächsten Wochen verbringen würde.










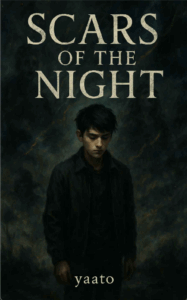













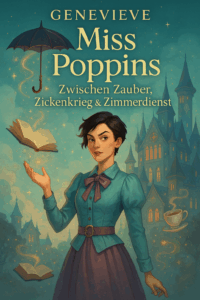

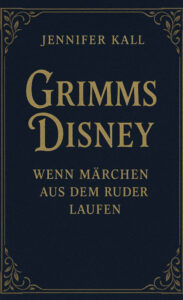











Kommentare