Kapitel 7: Leora

Meine Nacht war alles andere als erholsam. Ich hatte ständig Geräusche gehört, das Knacken von Holz oder den Wind, der gegen das Haus peitschte. Jedes Geräusch klang unheimlich, als ob es in dieser Dunkelheit eine andere Bedeutung hatte. Im dunklen hatte das Haus etwas beängstigendes.
Trotz des wenigen Schlafes beschloss ich, gegen 8 Uhr aufzustehen. Doch bevor ich mich für den Tag richtete, schrieb ich meiner Mum eine Nachricht. Ich erzählte ihr, wie es hier war und fragte sie, wie es ihr ging.
Als ich mich fertig gemacht hatte und ratlos im Flur stand, entschloss ich mich, kurz einen Blick in Eryons Zimmer zu werfen. Einfach nur, um zu sehen, ob alles in Ordnung war und ob er noch schlief. Vorsichtig öffnete ich einen Spalt der Tür und stellte fest, dass seine Augen immer noch geschlossen waren. Vielleicht war er einfach nur ein Langschläfer. Ich beschloss, später nochmal nach ihm zu sehen und mir beim Frühstück mehr Zeit zu nehmen.
Unten angekommen, wurden ich gleich von den beiden Katzen begrüßt. Die schwarze mit den grünen Augen, die ich gestern schon bemerkt hatte und der Orange Kater, der mir sofort wieder maunzend um die Beine strich. Der schwarze Kater jedoch, blieb misstrauisch stehen und musterte mich, als wüsste er nicht, was ich hier zu suchen hatte.
Schnell machte ich mich daran, die beiden Katzen zu füttern, da ich fast befürchtete, sie könnten mich sonst noch lebendig fressen, wenn ich mich nicht beeilte. Nachdem ich das erledigt hatte, griff ich mir ein Müsli und nahm die Zettel mit in das Esszimmer. Dort verbrachte ich die nächsten Stunden damit, mich mit den Regeln auseinanderzusetzen – was ich tun durfte und was ich auf keinen Fall machen sollte.
Es gab eine Menge zu beachten und anscheinend sollte ich sogar die Hühner und Gänse draußen füttern. Aber was mich am meisten beschäftigte, war die Liste von Verboten für Eryon. Es schien, als dürfte er einfach gar nichts. Den ganzen Tag im Bett liegen und vor sich hin gammeln. Aber das konnte doch nicht alles sein, oder? Ich wollte nicht, dass ihm langweilig wurde.
Selbst überlegte ich, ob ich so ein Leben führen wollen würde – einfach nur vor mich hin vegetieren und von Onkel und Tante wie ein Gefangener behandelt werden, dem jeder Spaß verwehrt wurde. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Also beschloss ich, die ein oder andere Regel zu brechen, um herauszufinden, was ihm wirklich guttat, auch wenn das riskant war.
Was mich zusätzlich stutzig machte, war das Fehlen jeglicher Angaben zu Eryons Krankheit. Hatten sie nicht irgendwo festhalten müssen, was genau mit ihm los war? So hätte ich wenigstens nachlesen und recherchieren können, um besser vorbereitet zu sein. Doch nirgends fand ich eine Erklärung. Es war, als ob niemand wollte, dass ich mehr darüber wusste.
Seufzend ging ich wieder in die Küche und machte mich daran, ihm drei Brote zu bestreichen. Es fühlte sich an, als dürfe er nur Wurst und Käse essen – keinen anderen Brotaufstrich, kein Müsli, kein Obst. Kein Wunder, dass er so blass war, wenn er keine Vitamine bekam.
Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf und ich entschied mich, eines der drei Brote mit Honig zu bestreichen. Schließlich war da kein Fruchtzucker drin, der ihm eventuell schaden könnte und gegen Honig sprach wirklich nichts.
Mit den drei bestrichenen Broten und frischem Wasser ging ich also wieder nach oben. Ich fühlte mich wie ein Hausmädchen.
Es war schon fast 11 Uhr, also nahm ich an, dass er längst wach sein musste. Doch als ich vorsichtig in sein Zimmer trat, war er immer noch tief in Schlaf versunken. Meine erste Reaktion: Panik. War er etwa tot? Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich das Essen abstellte und das Licht anschaltete.
Doch selbst das ließ ihn nicht aufwachen. Nur an seinem Bauch konnte ich sehen, dass er atmete – aber wie fest war er in seinem Schlaf? Zögerlich zog ich mir die Handschuhe an, unsicher, was als Nächstes kommen würde.
„Eryon“, versuchte ich es vorsichtig und leise, doch er wachte wieder einmal nicht auf. Wie konnte man nur so fest schlafen? Selbst als ich seinen Namen diesmal etwas lauter rief, passierte nichts.
In meinem FSJ war es immer so, dass die Morgenroutine bis spätestens 9 Uhr morgens abgeschlossen sein musste, weshalb ich es gewohnt war, Patienten zu wecken. Aber es war einfach etwas anderes, einen Mann, der in etwa meinem Alter war, zu wecken, als eine alte Dame, die nicht mehr wusste, wie ihre Kinder hießen.
Ich spürte, wie eine Mischung aus Unsicherheit und Sorge in mir aufstieg. Was, wenn etwas mit ihm nicht stimmte? Die Gedanken rasten durch meinen Kopf, bis ich mich entschloss, ihn vorsichtig zu berühren.
Mit einer Hand, die sicher durch den Handschuh geschützt war, legte ich sie sanft auf seinen Arm. Ich schüttelte ihn vorsichtig, fast zögerlich. Und tatsächlich, seine Augen öffneten sich sofort und blickten mich mit Angst an. Ich sah, wie er bei meiner Berührung zuckte – ein fast unwillkürlicher Reflex – und sofort zog ich meine Hand zurück, als hätte ich etwas Falsches getan.
„Guten Morgen“, sagte ich mit einem beruhigenden Lächeln, obwohl ich mich selbst nicht ganz sicher fühlte. „Tut mir leid, dass ich dich so wecken musste. Du bist einfach nicht aufgewacht und ich hab mir schon Sorgen gemacht“, beichtete ich ihm leise.
Sein ängstlicher Ausdruck wich langsam einer Verwirrung und er entspannte sich allmählich. Wie gestern sah er mich nun wieder normal an, vielleicht sogar mit ein wenig Interesse. Doch in diesem Moment fühlte ich mich irgendwie unwohl.
Der Raum war zu still und trotz des Tageslichts draußen war es drinnen düster, als würde das Zimmer die Sonne irgendwie verschlucken. Ich spürte eine Kälte, die von den dicken Vorhängen ausging, die immer noch zugezogen waren – mitten am Tag.
Ich erinnerte mich an die strikte Regel, dass die Vorhänge stets geschlossen bleiben sollten. Doch das konnte doch niemandem gut tun, oder? Der Raum wirkte so trüb und er schon so bleich. Es war fast, als ob der Mangel an Licht ihn noch mehr in seiner Schwäche festhielt.
„Ich weiß, dass mir gesagt wurde, die Vorhänge immer zu lassen, aber… vielleicht können wir wenigstens ein kleines bisschen Licht reinlassen?“ fragte ich unsicher, während mein Blick zu den schweren Vorhängen wanderte. Als ich zu ihm sah, folgte sein Blick jeder meiner Bewegungen. Doch natürlich blieb er stumm.
Also zog ich den Vorhang einen Spalt breit auf. Doch bevor ich ihn weiter öffnen konnte, hörte ich plötzlich ein Fauchen. Es war kein normales Fauchen – es ging mir durch Mark und Bein, klang nicht menschlich, nicht natürlich.
Sofort drehte ich mich zu Eryon um. Sein ganzer Körper war angespannt, als würde er sich unter Schmerzen winden. Seine Hände krallten sich ins Bettlaken, seine Zähne waren fest aufeinander gepresst. Ich erstarrte, zog den Vorhang hastig wieder zu.
„Tut mir leid. Kein Tageslicht. Verstanden“, murmelte ich entschuldigend und begegnete seinem Blick. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, nicht in braune, sondern in tiefrote Augen zu sehen – genau wie gestern. Doch kaum, dass ich blinzelte, waren sie wieder normal. Vielleicht spielte mir meine Müdigkeit einen Streich.
Ich schüttelte leicht den Kopf, versuchte, meine Gedanken zu ordnen und zwang mich zu einem aufmunternden Lächeln. „Ich hab dir etwas zu essen mitgebracht. Eigentlich sollte es dein Frühstück sein, aber jetzt ist es wohl eher Mittagessen“, meinte ich mit einem leichten Lachen, um die angespannte Stimmung aufzulockern.
Aber in meinem Hinterkopf nagte noch etwas anderes an mir: Die Spritze. Ich wusste nicht genau, wann Rebecca und Johannes ihm gestern Morgen die Dosis verabreicht hatten. Vielleicht hatten sie ihm mehr gegeben, um den Zeitunterschied auszugleichen. Trotzdem… ich musste mich langsam darum kümmern.
Ich stellte das Bett wieder richtig ein und platzierte das Essen vor ihm. „Möchtest du es selbst versuchen?“ fragte ich und ließ meinen Blick kurz über seinen Arm wandern.
Wieder bemerkte ich ein leichtes Zucken in seinen Fingern, als würde er es wirklich probieren. Doch dieses Mal schaffte er es nicht einmal, die Hand zu heben. Er wirkte erschöpfter als gestern, schwächer – oder vielleicht war er einfach nur ein Nachtmensch?
Trotzdem wunderte es mich, dass niemand ihn förderte. Keine Ergotherapie, keine Physiotherapie, nichts. Dabei schien er doch in der Lage zu sein, kleine Bewegungen zu machen. Wäre es nicht sinnvoll, das zu trainieren? Aber es war nicht meine Aufgabe, das zu hinterfragen.
Also begann ich, ihm das erste Brot zu geben – zuerst das mit Käse, dann das mit Wurst. Währenddessen spürte ich seinen Blick auf mir, durchgehend, ununterbrochen. Es war nicht unangenehm, aber es ließ mich irgendwie nervös werden.
Ich konnte Stille noch nie gut ertragen. Also begann ich einfach zu reden. Ich erzählte ihm, warum ich hier war, von meiner Mum, davon, wie sich alles so plötzlich verändert hatte. Vielleicht klang es, als wollte ich Mitleid – aber das war nicht meine Absicht. Ich wusste nur nicht, wohin mit meinen Gedanken. Und na ja… was anderes als mir zuhören, blieb ihm ja ohnehin nicht.
„Okay, ich weiß, dass du fast gar nichts essen darfst, aber… ich würde einfach nicht glücklich sein, wenn ich nur Wurst- und Käsebrot essen dürfte.“ Ich lachte nervös und drehte das Brot in meinen Händen. „Deshalb dachte ich, ich schmiere dir ein Honigbrot. Du musst es nicht essen, aber ich wollte es einfach mal versuchen.“
Mein Magen zog sich leicht zusammen. Vielleicht war es keine gute Idee, gleich die nächste Regel zu brechen. Die Sache mit den Vorhängen war schon schiefgegangen. Aber was sollte Honig schon ausmachen? Wenn sie mir nicht einmal sagen wollten, welche Krankheit er hatte, konnten sie wohl kaum erwarten, dass ich mich daran hielt.
Zögernd hielt ich ihm das Brot hin. Und zu meiner Überraschung biss er ab.
Dieses Mal schloss er die Augen, als er kaute. Ich erstarrte kurz, wusste nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Doch als er sie wieder öffnete, war da etwas – nur ein Hauch, aber dennoch – das einem Lächeln glich.
Und dann, so schnell, dass ich es kaum fassen konnte, war das Honigbrot verschwunden.
Seine Augen wirkten heller, fast… lebendig.
Kurz darauf brachte ich ihn ins Bad, ließ ihn aufs Klo, während ich routiniert die Spritze aufzog. Ich kannte den Ablauf inzwischen. Die Spülung rauschte und als ich zurückkam – genau wie gestern – saß er bereits im Rollstuhl.
Aber wie?
Er konnte nicht einmal seine Hand heben. Und doch schaffte er es jedes Mal, von allein zurück in den Stuhl zu kommen.
Ich gab ihm die Spritze, worüber er – wenig überraschend – nicht gerade glücklich schien. Dann half ich ihm, sich umzuziehen und zu waschen. Es ging schnell, fast routiniert. Ich achtete darauf, ihn nicht zu sehr anzuschauen, denn seine kleinen Mimikänderungen und Gesten machten mir deutlich klar, dass er das nicht wollte.
Als ich ihn wieder in sein Bett legte, schlief er innerhalb weniger Sekunden tief und fest ein.
Zu schnell.
Ich runzelte die Stirn und beobachtete, wie sein Atem sich verlangsamte. Lag das an seiner Krankheit? Oder waren es die Medikamente?
Ich biss mir auf die Lippe. Was auch immer es war – ich würde ihn erst einmal schlafen lassen.
Ich hatte genug zu tun. Die Tiere mussten versorgt werden, das Haus war riesig und der Garten war eine Katastrophe. Aber danach… danach wollte ich etwas mit ihm unternehmen.
Solange ich hier war, würde ich nicht zulassen, dass er einfach vor Langeweile vor sich hinvegetierte.










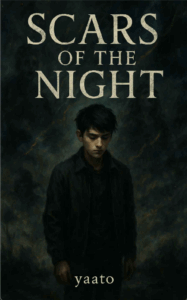













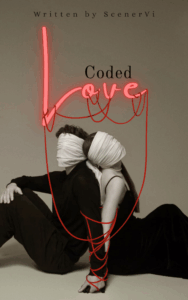








Kommentare