Epilog
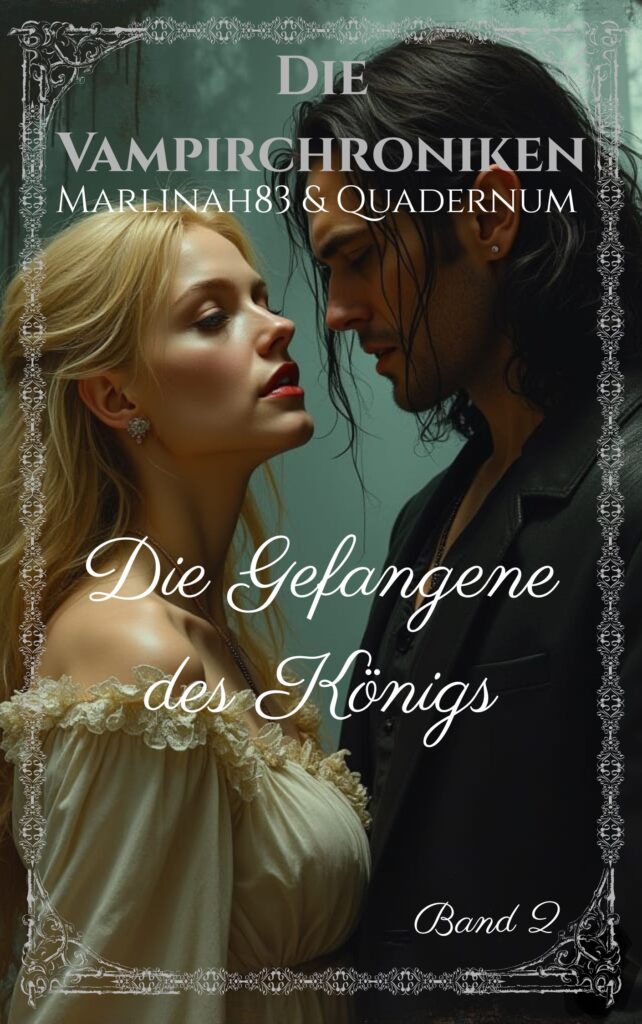
Epilog
Der König der Strasse
Lustlos trat ich gegen einen Stein, der daraufhin ein, zwei Meter weiter flog. Ich hasste diesen Hof. Die Arbeit hier war beschwerlich und die Tage viel zu lang. Außerdem hatte ich hier niemanden. Tyra zählte nicht. Mit der konnte ich nicht reden. Worüber auch?
Wenigstens weinte sie nicht mehr so viel wie am Anfang. Ja, natürlich war es dramatisch, dass sie ihre Familie verloren hatte. Aber dass sie sich deswegen jede Nacht in den Schlaf weinte, ging mir am Anfang nun mal gegen den Strich. Das hatte ich auch nicht getan. Zum Glück wurde es weniger. Ihre bescheidene Laune hingegen blieb. Ein Wunder, dass sie verheiratet gewesen war. Wie das arme Schwein sie wohl ausgehalten hatte?
Ich hievte den Werkzeugkasten hoch. Mit knurrendem Magen ging ich den Zaun ab. Immer wieder versuchten wilde Tiere, hindurch zu kommen. Jeden verfluchten Morgen musste ich den Zaun entlang gehen und prüfen, ob er noch stabil war. Das war wenigstens nicht ganz so anstrengend wie die sonstigen Aufgaben. Entsprechend brauchte ich dafür so manches Mal mehr Zeit als eigentlich nötig.
Auf der riesigen Weide grasten Kühe. Sie taten nichts anderes als fressen, kacken und schlafen. Natürlich musste ich sie auch melken. Jede einzelne Kuh. Die hörten gar nicht auf, Milch zu geben. Mir fielen davon immerzu beinahe die Arme ab, denn bis da endlich Milch herauskam, dauerte es. Ab da musste man nur noch leicht drücken. Aber bei vier Eutern pro Kuh und fünfzehn Kühen dauerte das den halben Tag.
An einer Stelle war der Zaun wackelig. Ich würde bald die Bretter austauschen müssen. Bretter, die ich beim Schreiner bestellen musste. Tyra würde wieder nur meckern, weil es so viel kosten würde. Wenn es nach ihr ginge, würde sie noch verlangen, dass ich selbst in den Wald ging, einen Baum fällte und ihn zurecht sägte. Sollte sie den Mist doch selbst machen, wenn sie so geizig war, ging es mir durch den Kopf.
Nachdem ich den Zaun notdürftig repariert hatte, ging ich zurück ins Haus. Tyra hatte Frühstück gemacht. Kochen konnte sie, das musste ich ihr lassen. Eigentlich war das Essen der einzige Grund, warum ich überhaupt noch hier war. Viel lieber wäre ich wieder zurück gelaufen. Da hatte ich meine Freunde. Da kannte ich mich aus und konnte den ganzen Tag machen was mir gefiel. Dort gab es keinen, der mir Vorschriften machte. Jetzt musste ich arbeiten.
Die ersten Wochen hatte ich jeden Tag Muskelkater. Meine Hände schmerzten und es gab kaum einen Tag, an dem ich mich nicht verletzt hatte. Am Anfang hätte ich gar nicht weglaufen können. Der Muskelkater hatte dafür gesorgt, dass ich diesen Hof nicht verlassen konnte. Jeder verdammte Schritt hatte wehgetan.
Irgendwann war es besser geworden. Und meine Gedanken, einfach abzuhauen, weniger. Und wenn ich daran dachte, wie oft ich mit knurrendem, leerem Magen hatte einschlafen müssen … Als ich kleiner war, hatte ich oft geschlafen. Es gab nichts zu essen. Meine Mutter lag immer nur im Bett, trank und jammerte. Meinen Vater störte es nicht, er machte ihr trotzdem ein Kind nach dem anderen.
Als ich das erste Mal klaute, war es frisches Brot. Ich brachte es nach Hause, um es meinen jüngeren Geschwistern zu geben. Aber Vater nahm es mir weg. Er wollte gar nicht wissen, woher ich es hatte. Die Hälfte davon aß er ganz alleine. Wir mussten uns den Rest teilen. Ich und meine sechs Geschwister.
Mein Blick ging gen Himmel. Bei Tyra konnte ich mich das erste Mal in meinem Leben satt essen. Die ersten Tage hatte ich mich wegen ihrer schlechten Laune gar nicht getraut, nach mehr Essen zu fragen. Ich nahm mir heimlich immer noch etwas. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Zudem versteckte ich immer etwas in meinem Zimmer. Eine alte Abstellkammer oder so. Denn sie wollte nicht, dass ich hoch in ihr Reich ging. Dort, wo sie schlief. Ihr Sohn und ihre Tochter hatten je ein eigenes Zimmer gehabt. Bei meinen Eltern hatte ich nicht mal ein eigenes Bett.
„Wir brauchen Bretter“, erklärte ich, während ich den Brei aß. Ich sah nicht von meiner Schüssel auf. „Der Zaun am Wald wird immer wieder angegriffen. Wölfe, denke ich.“ Vor einer Woche hatten sie es geschafft und eine Kuh gerissen. Die Sauerei hatte ich natürlich beseitigen müssen. Dafür hatte es an diesem Tag frisches Fleisch und keinen eintönigen Getreidebrei oder Käse mit Brot gegeben.
„Weißt du, wie teuer die Bretter sind?“, fauchte Tyra.
Ich zuckte mit den Schultern. „Sind nicht meine Kühe“, entgegnete ich und schaufelte den nächsten Löffel in meinen Mund. Wenn ich später noch Zeit hätte, könnte ich in den Wald gehen und Beeren pflücken. Bald sollten auch die Nüsse reif genug sein, damit schmeckte der Brei wahnsinnig gut.
Sie seufzte. „Schön. Ich muss bald sowieso in die Stadt. Willst du mit?“
Ich ließ den Löffel sinken und sah die Frau an. Ihre Augenringe waren nicht mehr so dunkel. Sie war früher bestimmt mal hübsch gewesen. „Nein“, meinte ich und machte mich wieder über den Inhalt meiner Schüssel her. „Habe keine Lust.“
„Du könntest deine Freunde besuchen. Oder deine Familie.“
„Hab keine Freunde.“ Und keine Familie mehr. Meine Mutter war letzten Sommer gestorben. Kurz nach der letzten Geburt. Wahrscheinlich war es besser so. Das Neugeborene hatte mein Vater einfach im Wald ausgesetzt. Wir hatten eh keinen Platz, kein Essen, einfach nichts. Der Winter war hart, meine jüngste Schwester starb am Fieber, ein Bruder wohl an Hunger. Er schlief ein und wachte nie wieder auf.
Als es im Frühjahr endlich wärmer wurde, hatte ich nur noch vier Geschwister. Wir hatten gehofft, wir könnten betteln, klauen … irgendwas. Wenn das Wetter schöner wurde, wurden die Leute leichtsinnig.
Womit ich nicht gerechnet hatte, war mein Vater, der uns mitten in der Nacht weckte. Wir wurden aus dem Haus gezerrt, gefesselt und auf einen Karren gebracht. Keine Ahnung, wo wir hingebracht werden sollten. Ich hatte mich noch im Schutze der Dunkelheit wieder vom Karren geworfen und weglaufen können.
Die ganze Nacht hatte ich gebraucht, um zurück zu meinem Vater zu laufen, der mich daraufhin grün und blau prügelte. Immerhin hatte er mich verkauft. An irgendeinen verfluchten Blutsauger. So wie der Mistkerl, der mich gezeugt hatte, auch meine Geschwister verkauft hatte. Und er schwor, er würde mich umbringen, sollte ich ihm je wieder unter die Augen treten. Ich hingegen schwor mir, ihm irgendwann unter die Augen zu treten, um dasselbe zu tun. Aber erst, wenn ich wusste, an welchen verdammten Blutsauger er meine Geschwister verkauft hatte.
Natürlich kam es nie dazu. Wie auch? Ich war erst dreizehn und viel zu schwach, als dass ich es gegen einen Mann seiner Größe aufnehmen könnte. Daher tat ich, was ich am besten konnte. Ich klaute. Jeden Tag aufs Neue. Bis ich den falschen Goldsack aufschlitzte.
Im Nachhinein betrachtet war es das Beste, was mir passieren konnte. Und der König … Irgendwie war der ausgesprochen fähig. Auf eine gute Art und Weise. Also, zumindest für die, die auf seiner Seite waren. Ich konnte mir gut vorstellen, dass der schon ein paar Leute umgebracht hatte. Wie den alten König. Aber er hätte ruhig noch ein paar mehr Vampire töten können. Ohne sie waren wir besser dran. Wir brauchten die Blutsauger nicht. Sie machten alles kaputt, nahmen sich, was sie wollten, und zerstörten dabei gewissenlos.
Den ganzen Nachmittag verbrachte ich damit, die Kühe zu melken. Daraus würde Tyra Butter machen. Oder Käse. Sie verkaufte viel davon. Natürlich sah ich von dem Gewinn nichts, aber irgendwann würde ich das Versteck, in dem sie das Gold lagerte, finden. Dann würde ich es mir nehmen, meine Geschwister freikaufen und …
Pferde näherten sich. Kurz darauf stand ich dem König gegenüber. Dem verdammten König der Vampire. Ein Teil von mir wollte ihm ein Messer in den Hals stecken. Und ich verfluchte mich selbst, weil sich der größere Teil in mir freute, ihn wiederzusehen. Blutsauger hin oder her, er hatte mir nichts getan und mir sogar die Bleibe hier organisiert. Auch dafür kassierte Tyra sicher gut. Trotzdem ließ sie mich schuften, als wäre ich ein Sklave.
Nachdem ich die Pferde versorgt hatte, eilte ich ins Haus. Ich wollte unbedingt wissen, warum der König hier war und wer der Kerl war, der ihn begleitete. Wollten sie was von Tyra oder von mir? Würde sie mich an den König verkaufen?
Als ich dazu kam, saßen sie im Esszimmer. Tyra stellte Brot, Käse und Wurst auf den Tisch. Es gab sogar geröstete Zwiebeln und Schinken!
Ich hatte mich schon gesetzt, da traf mich Tyras mordender Blick. „Zieh dich gefälligst um und wasch dir die Hände!“
Mein Blick ging zum König. Der hatte sich auch umgezogen. Ein braunes Baumwollhemd und eine schwarze Hose hing ihm am Leib. Er sah eigentlich ziemlich schäbig aus für einen König. Der Mann neben ihm war ganz anders. Eine Narbe im Gesicht, die irgendwie gut aussah. Teure, glänzende Kleidung. Was war wohl teurer? Die Sachen, die er trug, oder ein Sklave? Wie viel hatte mein Vater dafür bekommen, dass er seine Kinder verkauft hatte? Nur allein der Schmuck, den der Kerl trug, musste genug sein, um meine Geschwister freikaufen zu können!
„Elaboris! Geh und wasch dich!“, keifte Tyra. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass der König der Vampire grinste. Mein Name war dermaßen peinlich. Und in diesem Moment bereute ich es, dass ich ihn Tyra genannt hatte. Eigentlich nur, weil ich es leid war, dass sie mich ständig ‚Junge‘ nannte.
Während ich aufstand, zog ich den Stuhl so laut wie möglich zurück. Ich hatte keine Lust, mich umzuziehen. Oder mich zu waschen. Nur, um den feinen Herren zu gefallen. Tyra war es egal, wie ich aussah. Sie gab mir etwas zu essen und ich schuftete mir für sie den Buckel krumm. Ich hätte wetten können, ihr Sohn musste nicht so hart anpacken.
Einige Minuten später saß ich wieder am Tisch. Ein halbwegs sauberes Hemd tragend, die Hände sauber. Mehr oder weniger. Der Dreck unter den Fingernägeln wollte nicht weg.
Wir aßen zusammen. Befremdlich. Ich wusste gar nicht, dass Vampire auch aßen. Sicher, das hatte der König auch getan, als ich bei ihm war. Die anderen nicht. Aber hier, an diesem Tisch, fühlte es sich seltsam an. Sie gehörten nicht hier her.
„Also. Was wollt ihr hier?“ Ich unterdrückte ein Grinsen. Tyra respektierte die Vampire noch weniger als ich. In diesem Moment mochte ich sie irgendwie sogar.
„Ich hörte, was hier passiert ist. Mein aufrichtiges Beileid“, sagte der Mann, der neben dem König saß.
„Spar dir das“, entgegnete Tyra schroff. Schnell trank ich einen Schluck Milch, um mein Grinsen zu verbergen. Der Kerl sah zum König und dann wieder zu Tyra. „Ich bin Herzog Lelier und möchte dir ein Angebot machen. Dieser Hof liegt sehr zentral. Mehrere große Höfe liegen in der Nähe. Mehrere Städte sind gut zu erreichen, wie auch die Hauptstadt. Und die großen Handelswege führen an hier ebenfalls vorbei. Jeder, egal woher er kommt, reitet hier durch.“
„Ich verkaufe mein Land nicht!“ Der Griff um ihr Messer, mit dem sie gerade noch ein Stück Käse abschneiden wollte, wurde fester.
„Das möchte ich auch nicht. Aber der Gedanke war, hier ein Haus für Frauen und Kinder zu errichten.“ Dieser Herzog meinte, dass es, da es keine Sklaverei mehr gäbe, nun immer mehr Menschen an einem Heim fehlte. Alte, schwache und kranke Menschen sollten hier leben. Mütter mit ihren Kindern sollten hier ein Zuhause finden. Eines, das der Herzog hier aufbauen wollte. Mit Tyra als Leiterin.
Der Gedanke, dass ausgerechnet Tyra eine heilige Samariterin werden sollte, ließ mich fast lachen. Die Frau hatte Haare auf den Zähnen! Sie würde nie …!
„Ich machs.“ Perplex sah ich auf. Ihr liefen sogar Tränen. „Ich möchte gerne helfen. Damit die Frauen nicht zurück in die Sklaverei gehen. Damit sie ihren Kindern etwas Besseres bieten können.“
Ich wurde ins Bett geschickt, damit die Erwachsenen reden konnten. Dabei war ich kein Kind mehr! Trotzdem wollte ich mich nicht mit Tyra anlegen.
Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Die Nacht hatte ich nicht gut geschlafen. Es war Ewigkeiten her, seit dem ich das letzte Mal mit Tränen in den Augen aufgewacht war. Denn ich hatte geglaubt, der König hätte wenigstens ein paar Worte mit mir wechseln wollen. Ich hatte gehofft, er wäre wegen mir gekommen.
Ich dummer Narr. Er hatte mich gesehen, das reichte ihm. Ich war schließlich nur ein dummer Junge. Und er war der König. Mit Wut und Enttäuschung im Bauch ging ich zum Stall. Ich fütterte die beiden Pferde und streichelte ihre Mähnen. Als ich neben mir ein Räuspern hörte, wandte ich mich schnell um.
Der König stand vor mir, einen Mundwinkel belustigt erhoben. „Du bist schon fleißig?“ Ich schwieg. Was sollte ich auch sagen? „Elaboris. Ein interessanter Name.“ Er trat weiter auf mich zu.
Ich war wie gelähmt. Es störte mich, dass er meinen Namen in den Mund nahm. „Nenn mich nicht so!“, presste ich zwischen den Zähnen hervor.
„Wie dann? Elab? Boris?“
„Ist doch eh egal.“ Ich drehte den Kopf beiseite. Wie lange es wohl dauern würde, bis er mich wieder besuchen käme? Käme er überhaupt noch einmal her? Wozu sollte er?
„Weißt du, ich habe gestern noch mit Tyra gesprochen. Ob sie einverstanden wäre, wenn ich dich mitnehme.“
„Wohin?“ Meine Kehle wurde plötzlich trocken.
„Mit zu mir. Ins Schloss. Du würdest mein Knappe werden.“
Alles in mir schrie danach, abzulehnen. Im Schloss wimmelte es nur so vor Vampiren. Ein Mensch wie ich würde dort nicht lange leben. Es gab schreckliche Geschichten über Blutorgien. Vampire ließen uns Menschen absichtlich verbluten und ergötzten sich an unserem Leid. Aber dann sah ich mich mitten in der Nacht gefesselt auf dem Karren. Meine Geschwister weinten leise. Ich hatte sie im Stich gelassen. Alle vier. Ich war abgehauen und hatte sie ihrem Schicksal überlassen.
„Ins Schloss“, wiederholte ich langsam. Sämtliche Alarmglocken läuteten in mir. Das war ein Ort, an den ein Mensch niemals gehen sollte. Aber vielleicht könnte ich dort herausfinden, wo meine Geschwister waren.
Der König nickte und sah mich geduldig, aber irgendwie auch eindringlich an. Ein Blick, bei dem ich unsicher wurde, der mich jedoch gleichermaßen herausforderte und mutig machte.
„Einverstanden. Unter einer Bedingung!“




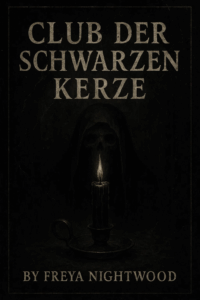



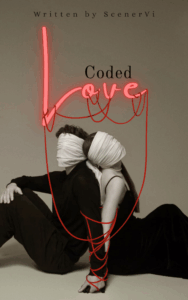





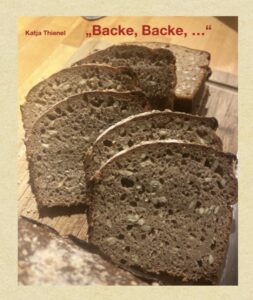



















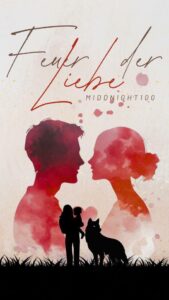



Kommentare