Kapitel 54 – Ein Preis, den es zu zahlen galt

Kapitel 54 – Ein Preis, den es zu zahlen galt
Aurelie
Mittlerweile war die Dämmerung hereingebrochen. Zahllose Stunden hatte ich noch mit meiner aufgezwungenen Anstandsdame verbringen müssen, doch nach diesem Kampf hatte es nichts und niemand mehr geschafft, mein Lächeln zu dimmen. Es lag auf meinen Lippen, ganz gleich, was mir jemand erzählte, von mir wollte oder verlangte. Der restliche Nachmittag mit Carina verging wie im Flug. Sie wurde von meinem Dauergrinsen mehr und mehr in den Wahnsinn getrieben, während ich in meinem Kopf immer und immer wieder den Kampf durchspielte und ihr keinen Deut Aufmerksamkeit zukommen ließ. Irgendwann wurde ihr Kopf hochrot. Ich glaube mich zu erinnern, sie hätte damit gedroht, mich ob meines Ungehorsams beim König anzuprangern, doch selbst diese Worte drangen lediglich gegen eine undurchdringliche Mauer aus Freude, Faszination und Traum. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben gegen jemanden gekämpft. Gegen meinen Gemahl. Und ich hatte gut abgeschnitten!
Als er zu Beginn nur relativ locker dagestanden hatte, hätte ich am liebsten sein Bein unter ihm mit meinem weggeschlagen, aber das hätte nicht funktioniert. Auch wenn ich es schon einige Male in einem Übungskampf beobachtet – und noch deutlich öfter geübt hatte – war mein Körper doch schwächer als seiner. Und beim Weinregal hatte es auch nicht funktioniert. Als ich ihn schließlich so weit getrieben hatte, dass er begann, mich einigermaßen ernst zu nehmen, war meine Laune für den restlichen Tag besiegelt.
„Wieso grinst sie eigentlich schon die ganze Zeit so blöd?“, hörte ich Aurillia Emili ins Ohr flüstern, wobei der Sinn des Flüsterns deutlich misslang. Gleich darauf griff sie nach einem warmen Hühnerschenkel und biss kräftig hinein, den Blick unverwandt auf mich gerichtet. Die um ihren Mund verschmierte Marinade wurde ignoriert.
Als mir nun auch Emili einen nicht zu ergründenden Blick zuwarf, wuchs mein Grinsen nur noch an. Meine Mundwinkel zogen sich beinahe schon schmerzhaft nach oben, aber da war kein Weg, wie es anders hätte sein können.
„Hat diese Carina ihr vielleicht aufgetragen mehr zu Lächeln? Und das ist der … dabei herausgekommene Versuch?“, mutmaßte Emili etwas leiser als Aurillia, aber auch ihr Blick klebte an mir wie Harz am Baum.
Aurillia kniff die Augen zusammen und musterte mich skeptisch. „Aber … es sieht aus, als … gut, das macht mir Angst. Nayara, bitte hör auf damit.“ Irina hielt sich gerade noch rechtzeitig die Hand vor den Mund, ehe sie ihr soeben getrunkenes Abendmahl wieder ausspucken konnte. „Hey! Behalt das schön drin!“, setzte die Blondine energisch nach und deutete anklagend auf Irina. Diese schluckte einmal schwer, hob unschuldig die Hände und prustete dann los.
„Also ich habe gehört, unsere Königin hat sich ein Schwertduell mit dem König geliefert“, streute Irina unschuldig guckend in die Runde und zwinkerte mir verschmitzt zu. Grunzend schüttelte ich den Kopf.
„Was?!“, riefen beide Mädchen gleichzeitig, Fassungslosigkeit und Entsetzen auf ihren Gesichtern prangend. „Er hat dich gezwungen, ein Schwert zu führen?“, setzte Emili nach.
Hastig schüttelte ich den Kopf. „Nein. Er hat es mir lediglich angeboten. Und als ich die Herausforderung angenommen habe, guckte er mehr erschrocken als zufrieden, also war es seinerseits sehr wahrscheinlich als Scherz gemeint. Aber …“
„Aber unsere Königin war schon immer eher ein Freigeist“, merkte Irina verschmitzt an und schenkte mir einen liebevollen, mütterlichen Blick. Natürlich wusste sie von der Leidenschaft, die ich drei Jahre vergebens gehegt hatte. Aber damit war sie die Einzige. Und das sollte, so beschloss ich, vorerst auch so bleiben.
„Ja, ich wollte es einmal ausprobieren. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Das Unverständnis der anderen beiden schlug mir mit voller Wucht entgegen. „Ist das denn so abwegig?“, brummte ich leise und versuchte das sachte Stechen in meiner Brust zu ignorieren. Diese Reaktion war mir doch längst bekannt. Wieso sollte sie mich plötzlich tangieren?
Kurz war es still. Bald schon durchbrach Aurillia die Stille aber schon wieder mit schriller Stimme: „Hast du es ihm denn wenigstens gezeigt? Nachdem er sich dir in der Nacht so aufgedrängt hat?“
Emili knuffte ihr in die Seite, ich verdrehte die Augen und Irina verbrachte die meiste Zeit damit, ihre Fangzähne wieder einzuziehen. Ohne meinen Befehl zur Hilfe.
Das Essen verging, unsere Mägen füllten sich und die Sonne verschwand hinter dem Horizont. Nachdem mir die Mädchen ins Nachthemd geholfen und mir die Haare geöffnet und gepflegt hatten, verabschiedeten sie sich, um sich in ihr eigenes Kämmerchen zurückzuziehen. Beide waren ausgesprochen dankbar dafür, ein richtiges Bett zur Verfügung gestellt zu haben. Und da sie beide den ganzen Tag im Schloss mitarbeiteten, fielen sie nun müde und erschöpft ins Bett. Irina blieb noch eine Weile bei mir. Zusammen setzten wir uns zu einer Runde Schach, dessen Taktiken wir beide nicht im Geringsten beherrschten, und stritten uns so manches Mal um die Regeln. Mit einer innigen Umarmung verabschiedete ich mich schließlich von meiner Freundin. Sie hatte ein eigenes Gemach bei den anderen Grigoroi zugeteilt bekommen und auch sie genoss die Möglichkeit, etwas Privatsphäre zu haben, sichtlich.
Still setzte ich mich auf die Bettkante und wartete. Worauf konnte ich nicht so recht sagen. Ich war noch nicht müde, trotz des eigentlich anstrengenden Tages. Wieder, wie so oft heute schon, ließ ich den Kampf in meinem Kopf Revue passieren und lächelte dabei. Ich hatte mich von meinem Gemahl das erste Mal überhaupt richtig ernst genommen gefühlt. Für einen kurzen Moment – den, in dem er erkannt hatte, dass ich sehr wohl mit dem Schwert umzugehen wusste – hatte es sich richtig angefühlt. Das alles hier. Dass ich nun hier auf dem Bett der Königin saß. Dass ich selbst die Krone trug, so schwer sie auch noch liegen würde in der Zukunft. Und dass ich die Klinge mit meinem Gemahl gekreuzt hatte. Nicht auf Leben und Tod, sondern um zu üben. Wie sich die Muskeln an seinen Armen gewölbt hatten, wenn er das Schwert hob. Wie sie sich entspannt hatten, wenn er es niedrig hielt. Wie die Muskeln an seinem Rumpf deutlich hervorgestochen waren, als er eine schnelle Drehung vollführt hatte. Und das trotz der Tunika. Verträumt dachte ich wieder darüber nach, wie es sich noch an diesem Morgen angefühlt hatte, über sie zu streichen. Wie meine Finger sachte die weiche Haut berührt hatten. Wie mein Kopf auf seiner Brust gelegen war und ich seinem Herzschlag gelauscht hatte. Und wie seine Hand schwer und warm auf meinem Rücken gelegen war, ruhig und sicher.
Wie in Trance blickte ich irgendwo ins Nirgendwo und ging in meinen Gedanken den gesamten Tag noch einmal durch. Es war unglaublich gewesen. Irrsinnig. Und es juckte mich in den Fingern, den nächsten Tag wieder so beginnen zu lassen. Ich könnte mich in sein Gemach schleichen. Vielleicht schlief er schon. Und wenn nicht, und ich nicht bleiben durfte, könnte ich behaupten, ich hätte einen Albtraum gehabt. Ich könnte mich wieder an ihn anlehnen und ihn streicheln. Leise Worte austauschen, die nicht von Hass, Wut, Unglaube oder Vorurteilen geprägt waren.
Plötzlich ging die Tür zu meinen Gemächern auf. Wenig später stand Irina in meinem Schlafzimmer und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Unterleib.
Schnell schüttelte ich den Kopf, in verzweifelter Hoffnung, die Hitze wieder aus meinen Wangen zu vertreiben.
„Naya, ich …“ Gequält verzog sie das Gesicht und unterdrückte einen jammernden Laut. „Ich habe ein Problem!“
Verdattert brauchte ich einen Moment, um zu reagieren. Ich verstand nicht, was los war, aber ich stürzte auf sie zu und griff ihr unter den Arm, um sie zu stützen. Grigoroi wurden nicht krank! Was war hier los? „Bist du verletzt?“, fragte ich überfordert und wollte sie zum Bett dirigieren, wogegen sie sich allerdings sträubte.
„Nicht hier!“, keuchte sie. Ich stützte Irina, die mir keuchend den Weg ins Bad wies. Dabei krümmte sie sich nach vorne. „Kann Blut schlecht werden?“, fragte sie gequält.
„Naja, es gerinnt und wird dick. Aber das Blut war frisch. Das riecht man.“ Das roch sogar ich. Vorsichtig half ich ihr ins Badezimmer, wo sie sofort weiter auf den Abort zulief. Dort hob sie den Rock und setzte sich darauf.
Verwirrt blieb ich in der Tür stehen und sah dabei zu, wie Irina das Gesicht unter Schmerzen verzog. „Du kannst keine Verdauung haben, Irina“, erklärte ich möglichst sachlich.
„Aber ich habe immer wieder Blut getrunken! Wo geht das denn hin?!“, fragte sie schnaufend. Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn.
„Naja, dein Körper nimmt sich das Blut. Dein Herz schlägt ja nicht mehr. Deshalb ist dein Magen eine Art Speicher.“ Ich überlegte, was ich früher gelernt hatte. „Du kannst eigentlich auch gar nicht schwitzen“, realisierte ich laut denkend.
Irina keuchte, schlug die Hände erst vor das Gesicht und dann drückte sie diese gegen ihren Bauch. „Das ist schlimmer als jede Verstopfung!“ Nach einigen Momenten sackte sie etwas in sich zusammen.
Ich war ratlos. „Soll ich eine Kräuterhexe rufen?“
„Nein!“, rief Irina ungewohnt schroff. Ihr Körper schien sich zu entspannen. Ging es ihr wieder besser?
„Kann ich dir irgendwie helfen?“ Mein Blick huschte umher und ich nahm ein Tuch, tauchte es in einen Eimer mit frischem Wasser und ging zögerlich auf Irina zu. Sanft strich ich mit dem Tuch über ihr Gesicht.
Bei dieser Geste riss sie plötzlich die Augen weit auf und ihr Mund formte sich zu einem ‚O‘ der Erkenntnis. „Ich glaube, wir müssen hier weg“, schnaufte sie, entspannte sich aber immer mehr.
„Warum? Wohin?“
„In den Wald. Denke ich. Niemand darf uns sehen!“ Ich verstand gar nichts mehr und trat irritiert einen Schritt zurück. Nur wenig später verzog Irina wieder unter Schmerzen das Gesicht und griff sich an den Bauch. „Wir … müssen … in … den … Wald!“, presste sie unter Schmerzen hervor.
„I…in Ordnung“, stammelte ich. „Warte kurz, ich werfe mir noch etwas über!“, rief ich ihr, schon halb aus dem Badezimmer raus, zu und eilte zum Schrank. Dort griff ich blindlings nach einem Hemd und einer Hose, beides locker und zweckmäßig. Wenig später kam ich Irina beim Aufstehen zur Hilfe. Ich dachte nicht darüber nach, wieso wir in den Wald und aus dem Schloss mussten. Wenn Irina das sagte, dann vertraute ich ihr. Kurz biss ich mir überlegend auf die Unterlippe. „Wir nehmen die Geheimgänge“, entschied ich. Zwar kannte sie diese nicht und sie würde mir zweifellos vertrauen müssen, aber wenn sie gänzlich ungesehen aus dem Schloss kommen wollte, war das der einzige Weg.
Zusammen verließen wir meine Gemächer. In meinem alten Kinderzimmer, nicht weit von den Gemächern der Königin, fand sich einer der Eingänge. Somit führte ich Irina dahin. Als ich ohne langes Suchen sofort den Auslöser fand, grinste ich zufrieden, während Irina ängstlich in die Dunkelheit vor uns starrte.
„Vertraust du mir?“
„Ja, natürlich. Sonst wäre ich nicht sofort zu dir gekommen, Naya“, erwiderte sie gezwungen lächelnd, jedoch besorgniserregend blass, und trat vor mir in den geheimen Gang ein.
Ich verschloss ihn leise hinter uns, nahm ihre Hand und führte sie durch die Dunkelheit. Dabei glitt meine Hand wie immer an der Wand entlang.
„Warte!“, keuchte Irina und blieb stehen. Ihr Atem ging schwerer und sie fing leise an zu wimmern. Als sie bemerkte, wie fest sie meine Hand mit ihrer drückte, liess sie schnell los. Es fiel mir schwer, tatenlos neben ihr zu stehen, während sie mit den Schmerzen rang. Behutsam streichelte ich ihren Rücken, bis sich Irina wieder entspannte. Trotzdem brauchte sie noch einen Moment, bis sie sich wieder aufrichtete. „Wir können weiter“, flüsterte sie leise.
Erneut griff ich nach ihrer Hand und tastete mich im Dunkeln weiter. „Hier sind Stufen. Dreizehn insgesamt.“
Wir gingen weiter durch das Labyrinth an Geheimgängen. Irina brauchte eine weitere Pause, bevor wir endlich den Ausgang passierten und uns frische Nachtluft entgegenwehte. Von hier aus ging es über den Übungsplatz und dann direkt in den Wald. Allerdings war Irina nicht ganz so schnell und so mussten wir vor dem Wald noch eine weitere Pause einlegen. Mein Blick glitt argwöhnisch hinauf zum Schloss. Aber es war alles dunkel. Ich sah keinen Schatten an einem der Fenster stehen.
„Nayara …, den Rest schaffe ich alleine. Danke für deine Hilfe …“
„Sicher nicht, bist du von Sinnen?“, entgegnete ich schroffer als beabsichtigt. „Du kannst kaum alleine stehen!“ Wieder griff ich ihre Hand und zog sie hinter mir her. Ich sah ihr an, dass sie etwas erwidern wollte, es aber schlussendlich mit einem angestrengten, gequälten Stöhnen dabei beließ.
Eine Weile stampfte ich durch den Wald, eine keuchende Irina im Schlepptau, ehe ich registrierte, dass ich noch immer nicht wusste, wieso wir hier waren oder wo genau sie hinwollte. Die Abstände, in denen wir eine Pause machen mussten, wurden immer kleiner. Die Pausen hingegen wurden immer länger.
„Naya …, wirklich … Du musst gehen!“, flehte sie beinahe und lehnte sich erschöpft an den Baum. „Du … du solltest das nicht sehen!“, brachte sie schluchzend hervor. Ihre Beine knickten ein und sie fiel erst auf die Knie, dann kippte sie zur Seite weg. Wieder stöhnte sie unter Schmerzen, deutlich lauter als zuvor.
„Was denn, verflucht? Irina, was geht hier vor?“ Besorgt kniete ich mich zu ihr hin und griff nach ihrer geballten Hand.
„Das Kind … das tote Kind muss raus!“, stöhnte sie unter Schmerzen. „Du sollst das nicht sehen!“
Ich erstarrte. Meine Brust hörte auf sich zu heben, ich hielt den Atem an und wusste auch nicht mehr, wie ich ihn wieder in Gang bringen sollte. „Das Kind meines Bruders?“, flüsterte ich, auf einmal weinerlich und klein fühlend.
„Wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch von einem anderen Vampir.“ Umständlich drehte ich Irina auf den Rücken. „Ich schaffe den Rest schon. Und morgen bin ich wieder ganz die Alte. Geh, Naya!“
„Sicher nicht!“ Ich war doch nicht blöd. Irina hatte mir bei unserer Teestunde im Kerker gesagt, wessen Kind das war. Und ich würde es nicht alleine lassen! Weder das Kind, noch Irina! „Ich lasse euch nicht alleine!“ Meine Stimme war in ein entschlossenes Weinen übergegangen.
„Aber es ist tot, Naya!“
Heftig schüttelte ich den Kopf, packte sie an den Fußgelenken und hob sie ungeschickt an. „Wir machen das jetzt zusammen! Ich habe das mal in einem Buch gesehen! Du musst die Beine anwinkeln!“
Irina fing erneut an zu wimmern, zu keuchen, aber sie konnte nicht widersprechen, weil sie erneut eine Welle des Schmerzes überkam. Obwohl sie versuchte, nicht zu schreien, klangen die Schmerzlaute schrecklich.
Ich hob ihren Rock an. Obwohl ich in der Dunkelheit eigentlich ganz gut sehen konnte, sah ich nichts. Aber ich wusste auch nicht, was ich sehen sollte. Das stand nicht in den Büchern. Nur, dass das Kind mit dem Kopf zuerst auf die Welt kam. Aber ich sah dort keinen Kopf! Wo überhaupt?
Irinas Beine begannen zu zittern, und ich streichelte intuitiv darüber. Sie schrie leise und gepresst durch die Zähne. Es dauerte lange, bis ich etwas zwischen ihren Beinen sehen konnte. So verdammt lange Zeit, in der Irina schrie und schrie und gar nicht mehr damit aufhörte! Doch was ich dann sah, sah keineswegs wie ein Kopf aus. Irina schrie wieder und im nächsten Moment kam das Ding raus. Unter Schrecken erkannte ich, dass das Kind noch eingepackt war. In eine Art … Sack. Aber es bewegte sich nicht. Nicht mal ein leichtes Zucken. Zitternd hielt ich den kleinen, schleimigen … Beutel, der in etwa die Fläche einer Manneshand besaß, in meinen Händen. „In Ordnung“, krächzte ich leise und sah von meinen Händen zu Irina auf. Mit aller Mühe wischte ich den Ekel aus meinem Gesicht. „Geht es dir gut?“
„Besser“, seufzte Irina leise, noch immer keuchend und doch deutlich erleichtert und streckte die Beine aus. „Es tut immer noch weh. Kein Vergleich zu vorhin.“
Ich nickte apathisch, suchte ihr Gesicht dennoch vorsichtshalber nach einer Lüge ab. Als ich keine erkennen konnte, ging mein Blick wieder nach unten zu meinen Händen. Ich schluckte schwer und dachte scharf nach. „Kannst du ihm bitte einen Namen geben?“ Kurz herrschte Stille und ich konnte mir schon vorstellen, wie Irina mich anschauen musste. Als hätte ich den Verstand verloren. Aber, auch wenn ich das Kind meines toten Zwillings wissentlich geopfert hatte, um ihr Leben zu retten …, verdiente es doch einen Namen! In mir stiegen Tränen hoch und meine Kehle verlautete ein leises Schluchzen, noch ehe ich es hätte negieren können. Eine Träne fiel auf den Beutel in meinen Händen. Hastig löste ich eine Hand und wischte sie weg, ehe ich ihn wieder mit beiden Händen griff. „Und dann müssen wir … ihn beerdigen.“
„Ein Junge“, murmelte Irina. „Avino. Ich möchte ihn Avino nennen.“ Vorsichtig setzte sie sich auf und rutschte langsam zu mir herüber. Auch sie starrte nun auf das Bündel. „Er ist geschützt.“
Noch immer nicht ganz bei mir, legte ich Irina das Bündel in die Hände und suchte blind nach einem Stock. Ich fühlte mich wie in Trance, wie in einem schlechten Traum. Mit dem Stock in der rechten und meiner bloßen, linken Hand fing ich an zu graben.
Nach einer ganzen Weile, in der weder Irina noch ich ein Wort gewechselt hatten, schniefte ich laut auf, setzte mich auf meine Fersen ab und nickte. Das Loch war groß und tief genug. Zumindest so tief, dass die wilden Tiere sich nicht gleich am Leichnam meines kleinen Neffen zu schaffen machen würden. Ich hielt Irina meine Hände hin. Ich wusste nicht, inwieweit sie sich mit diesem Kind verbunden fühlte. Ob sie es nur als todbringende Last gesehen hatte, oder ob sie vielleicht doch ein klein wenig Liebe für dieses Bündel voller Unschuld hätte aufbringen können.
„Hallo, Avino“, schniefte ich leise und schluchzte im nächsten Moment laut auf. Zahllose Tränen fielen auf das kleine Bündel in meinen Händen, während mein Atem nur zittrig aus meinen Lungen entwich. „Es tut mir so unglaublich leid. Mein kleiner Neffe. Dein Vater hätte dich sehr geliebt. Alex hätte dich sehr geliebt, sei dir dessen versichert.“ Meine Stimme bebte und aus meiner Kehle steigen Schluchzer der Trauer und des Verlusts. Trug ich meine Familie also doch noch zu Grabe. Zumindest der Rest, der Teil von ihnen, der mir geblieben war. Der Sohn meines Bruders, den ich nach jenem Tag nicht mehr wiedergesehen hatte. Ein bebendes Klagen entrang sich meiner Kehle, als ich erneut zu sprechen ansetzte und doch nicht mehr als ein Flüstern meine Lippen verliess: „Ich liebe dich.“
Wir legten das Bündel gemeinsam in das Loch. Und nicht nur mir liefen Tränen, als wir es wieder zuschütteten. Ich vernahm den Geruch von Blut. Irina ging es nicht gut. Trotzdem schaufelte sie immer wieder Erde auf das Loch. Am Ende stand sie auf und trat es mit den Füßen fest. „Komm, gehen wir …“





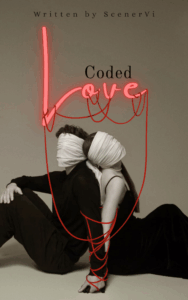





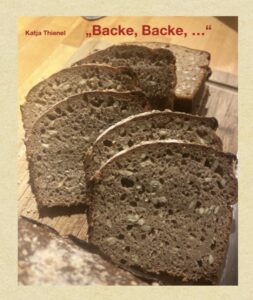






















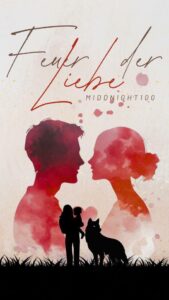

Kommentare