Kapitel 6 – Fieber

Kapitel 6 – Fieber
Rjna
Langsam öffnete ich die Augen. Sie waren verklebt, vermutlich vom Salz meiner Tränen. Wo auch immer ich die noch hernahm. War ich etwa schon wieder eingeschlafen? Vermutlich. Ich schätze, es ging jetzt wirklich zu Ende mit mir. Der Holzteller lag immer noch unter meiner Brust begraben, aber wirklich die Kraft, meinen Plan umzusetzen, hatte ich nicht. Woher auch?
Heiss. Ächzend versuchte ich, mit keinem Teil meines Körpers, einen anderen zu berühren. Ich war viel zu heiss, was mich selbst nur noch mehr aufwärmte. Dabei hiess ich, wohl zum ersten Mal überhaupt, den kalten Steinboden glückselig willkommen.
Kalt. Mich schüttelnd schlang ich meine Arme um mich herum und versuchte mich mit deren trägen Auf- und Abwärtsbewegungen zu wärmen. Die Reste meines einstigen Kleides drapierte ich so, dass sie möglichst viel meiner Haut bedeckten und mir auf diese Weise etwas Wärme spenden sollten, doch es half alles nichts.
Langsam, aber sicher kam in meinem Kopf an, was in letzter Zeit passiert war. Dass ich so dermassen lange dafür gebraucht hatte, lag vermutlich an meiner ständigen Bewusstlosigkeit. Immer wenn ich aufwachte, befand sich mein Kopf in schwummrigem Zustand und kam nicht wirklich dazu, einen klaren Gedanken zu fassen. Das karge Essensangebot und der stetige Blutverlust schickten mich in ein andauerndes Delirium.
Ich war gefangen genommen, in ein Verlies gesperrt und regelmässig um mein Blut erleichtert worden. Nach wie vor war es mir ein Rätsel, wie sich jemand von Blut ernähren konnte. Doch offensichtlich schmeckte es ihm. Er biss mir auch nicht immer in den Nacken. Einmal war er beschäftigt gewesen und hatte mich in seinem Büro empfangen. Dort hatte er mir stattdessen ins Handgelenk gebissen. Ein anderes Mal, da schubste er mich auf sein Bett, schob mein Kleid hoch, zerriss es dabei halb, und bediente sich an meinem Innenschenkel. Das war auch das letzte Mal gewesen, wo er explizit danach gefragt hatte, ob ich nicht doch das Bett mit ihm teilen wollte.
Nach dem Trinken wurde immer desinteressiert wieder von mir abgelassen. Nicht selten befand ich mich dann bereits im Land der Träume. Jeder Biss war ein Schmerz, der mich mich zu Vater zurückwünschen liess.
„Rjna?“, rief es durch die Dunkelheit. Dass ich nichts sehen konnte, daran hatte ich mich mittlerweile gewöhnt. Auch wenn es mich deutlich einschränkte. Andererseits hatte ich hier aber auch nichts zu tun, wofür ich mein Augenlicht bräuchte … und zu sehen gab es ebenfalls nicht besonders viel. „Rjna?“, schallte es erneut durch die Dunkelheit. Dieses Mal nahm ich auch wirklich Notiz von der Stimme. Mein Kopf bewegte sich leicht und träge nach rechts, um in die angrenzende Zelle zu sehen. Unnötig zu erwähnen, dass sich mir nichts als Schwärze offenbarte. „Rjna“, wimmerte nun eine Stimme. Und ich kannte diese Stimme! Aber woher? „Bitte hilf mir! Ich brauche dich, Schwester!“, wimmerte es hallend durch den Kerker und schneller, als ich noch dazu in der Lage sein sollte, war ich auf den Beinen. Zugegeben; auf sehr wackeligen Beinen, aber sie hielten dem Rest meines Gewichts gerade noch so stand.
„Fredi!“, rief ich aufgeregt, wobei Rufen wohl übertrieben war. Es war mehr ein Krächzen, das sich meiner Kehle entrang. „Wo bist du? Fredi? Bist du da?“
Stille.
Nein. Nein! Verdammt! Leise schluchzend lehnte ich mich an der Wand an und wünschte mir einmal mehr den Tod herbei. Wenn Fredi hier war … wenn sie hier war und noch lebte – taten sie ihr dasselbe an wie mir? Immer und immer wieder?
Mit neuem Mut fasste ich mir ein Herz und erhob meine Stimme: „Grinsebacke komm her! Du bist doch mein Wachhund, also komm!“ Wenn ich mich selbst so hörte, fragte ich mich, was nur aus mir geworden war. Mein Anstand, mein Respekt, meine Erziehung. Alles weg. Selbst die unterwürfige Haltung, die ich Vater gegenüber stets eingehalten hatte, konnte ich nicht mehr in mir finden. Ich war vollkommen leergefegt. Jede meiner Reaktionen beruhte auf Angst, oder dem ursprünglichen Instinkt zu überleben. Ich war nicht mehr besser als ein Tier.
Doch nun ging es um meine Schwester. Und mir war jedes Mittel recht, sie hier heil rauszubringen. Hatten sie etwa das gesamte Dorf hierher mitgenommen? Aber hätte ich deren Stimmen nicht längst hören müssen?
Tatsächlich näherten sich schon wenig später Schritte meiner Zelle. Grinsebacke trat auf die Gitterstäbe zu, begleitet vom unstetigen Flackern einer Fackel. Heute allerdings wurde er seinem Spitznamen nicht wirklich gerecht. Heute schien sein Gemüt eher verärgerter Natur.
„Da steht ja jemand auf eigenen Beinen. Bemerkenswert“, merkte er an, den Blick auf meinen, unter der Last meines Körpers zitternden, Unterkörper gerichtet. „Gerade, wenn man bedenkt, wie lange du schon hier bist“, murmelte er leiser, als wären die Worte nur an ihn selbst gerichtet. „So lange hat tatsächlich noch keine von Dregos Blutsklavinnen durchgehalten.“
Was meinte er damit? Es waren doch bestimmt nur einige Tage? Vielleicht ein oder zwei Monde … Aber mir fehlten allerlei Erinnerungen. Ich konnte nicht sagen, wie oft ich bei Drego war, wie häufig ich zu Essen bekommen hatte oder wie viele Male ich der Bewusstlosigkeit erlegen war. Ich wusste noch nicht einmal, wie lange ich bereits im Fieber lag. In meinem Kopf herrschte ein einziges Durcheinander und allein der Versuch über die vergangene Zeit nachzudenken, sorgte dafür, dass sich etwas in meinem Kopf schmerzhaft zu pochen begann Es fühlte sich an, als würde jemand mit Hammer und Meissel zuschlagen!
Grinsebacke musste mir meine Gedanken angesehen haben, denn nun sinnierte er weiter: „Du sprichst zwar mittlerweile regelmässig mit deinem Vater und einem … wie hiess er? Fredi? Vielleicht eine Abkürzung für Friedrich? Aber ansonsten scheint es dir ja noch halbwegs gutzugehen.“ Dieses Mal war es nicht nur blanker Hohn. Das zwar auch, doch es schien auch echte Verwunderung mit einem kleinen bisschen Respekt in seiner Stimme zu liegen.
„Lasst sie gehen. Ihr habt doch mich! Ihr müsst nicht auch noch meine Familie hier festhalten!“, flehte ich, mich vor Erschöpfung an die Gitterstäbe seitlich meiner Zelle klammernd. Möglichst weit weg von ihm.
Er lachte laut los, drehte sich kopfschüttelnd um und stieg die Treppen zum Kerker wieder hoch. Der Fackelschein verschwand. In der Dunkelheit liess ich mich kraftlos wieder zu Boden sinken. Das hatte ja viel gebracht.
„Rjri?“
Müde zwang ich mich erneut, die Augen zu öffnen. War bereits der nächste Tag angebrochen? Wie lange hatte ich geschlafen? Mein Kopf! Kalt! Bibbernd umschlang ich meinen Körper mit meinen Armen.
„Fredi“, flüsterte ich, als ich nach einigen Momenten wieder die Stimme meiner Schwester erkannte.
„Rjna du musst aufhören.“
„Was?“ Ich verstand vorne und hinten nicht, was sie damit meinte.
„Ich bin nicht echt Rjna.“
„Du fängst an zu spinnen, du dumme Nuss“, ertönte auf einmal die genervte Stimme Vaters.
Ich? Spinnen? Ward ich jetzt zur Frau geworden? Vater hatte doch immerhin gesagt, dass wenn man zur Frau wurde …
„Ach Rjna hast du es noch immer nicht begriffen?“ Das war Mutter.
„Mutter?“, fragte ich nach, doch sie antwortete nicht.
„Jetzt auch noch Mutter? Du enttäuschst mich, Kleine.“ Das war Grinsebacke, wieder ausgestattet mit seinem höhnischen Gesichtsausdruck. Wann war der wieder hergekommen? Was machte der jetzt schon wieder hier? Musste ich schon wieder zu Lord Drego? Wann war ich das letzte Mal? Ich konnte … mich nicht erinnern! „Lord Drego, das müsst ihr sehen!“, sagte Grinsebacke belustigt zu dem gerade eintretenden Lord Drego. Ich machte grosse Augen. Noch nie hatte er sich dazu herabgelassen, mich in meiner bescheidenen Zelle zu besuchen.
„Rjna hör auf! Du musst hier raus. Lass mich zurück!“, meldete sich Fredi wieder.
Mein Kopf schnellte herum zur Nachbarzelle, da, wo auch ihre Stimme herkam. „Sicher nicht! Ich lasse dich nicht allein! Hörst du mich? Fredi? Fredi antworte!“
„Bei den Göttern! Ich glaub, ich fall vom Glauben ab. So lange hat es noch keine durchgehalten, aber sie ist völlig dem Wahnsinn verfallen“, antwortete die Stimme Lord Dregos, sein Gesicht von einem ungläubigen Blick geziert.
„Ich bin nicht verrückt, ihr Idioten!“, schrie ich den beiden im Gang vor meiner Zelle zu.
„Hast du denn alles vergessen, was ich dich gelehrt habe, Rjna? Muss ich dich wieder züchtigen?“, drohte Vater.
„Nein, nein, Vater bitte nicht!“ Wieso flehte ich eigentlich? Hatte er jemals auf mein Flehen gehört?
Die zwei Männer im Gang starrten weiter entgeistert auf mich herab, während ich mich schluchzend in die Ecke meiner Zelle zurückzog.
Jetzt stand auch Vater in meiner Zelle. Wie war er dahin gekommen? Andererseits spielte das absolut keine Rolle, denn nun griff er nach seinem Gürtel. Augenblicklich versiegten meine Tränen und es kam kein Laut mehr aus mir heraus. Ich befand mich nicht mehr in der Zelle. Ich befand mich in unserer Hütte. Und gerade zeigte Vater mit einer Handbewegung auf die berühmt-berüchtigte Ecke, in der er immer die Bestrafungen vollzog.
Zitternd löste ich das zerfetzte Kleid von meinen Schultern und liess es zu Boden fallen. Daraufhin ertönte erschrockenes Keuchen von hinter mir, doch das spielte im Hintergrund. Vater machte mit einer Bewegung unmissverständlich klar, ich solle mich zu meinem Platz begeben. Und so tat ich es.
Und da war sie wieder. Die Unterwürfigkeit, die er mir in jede Faser meines Körpers gebläut hatte. Verspürte ich sie vielleicht nur gegenüber Vater? Doch Zeit darüber nachzudenken hatte ich keine. Ich begab mich auf die Knie, legte meine Handflächen an die Wand, drehte mein Kopf zu ebendieser. Ich mochte den Anblick Vaters nicht ertragen. Einmal hörte ich, wie er seinen Gürtel zu Boden schnellen liess und dieser ein lautes Klatschen verlautete. Ich zuckte zusammen. Ich hörte Gelächter, doch es spielte im Hintergrund. Es war mehr als unwichtig. Es war absolut bedeutungslos.
Leise wisperte ich: „Fredi es tut mir so leid.“ Ich wusste um meinen Zustand. Und ich wusste, ich würde Vaters Bestrafung so nicht überleben.
„Was macht ihr da?“, ertönte eine erhabene Stimme. Sie war durchdringender als die anderen, aber nichts vermochte die Wände unserer kleinen Hütte ganz zu durchdringen. Es war meine ganz eigene, persönliche Folter. War ich vielleicht sogar schon tot? War ich dem Fieber erlegen und wurde nun wegen meiner Gedanken bestraft? Vielleicht wollte der Dunkle mich nicht in seinem Reich. Ich hatte Vater oft Widerworte gegeben. Du sollst deine Eltern ehren. Das hatte ich nicht getan. Oder doch? Oder hatte ich mir selbst das Leben genommen? Ich vermochte es nicht, mich daran erinnern, doch das musste nichts heissen. In letzter Zeit konnte ich mich an Vieles nicht erinnern.
Sollte ich betteln? Aber es hätte keinen Zweck. Wenn ich tot und dies meine Bestrafung war, dann war die Kopie Vaters perfekt. Das hiesse auch, dass er nicht auf mich hören würde. Ganz im Gegenteil. Mein Flehen würde die Strafe nur noch verschlimmern. Doch wenn ich wirklich im Reich des Dunklen war, wie konnte es dann sein, dass Fredi hier war? Sie gehörte nicht in diese Welt!
„Vater …, tut mit mir, was Euch beliebt, aber lasst Fredi in Ruhe, ich flehe Euch an! Lasst meine kleine Schwester in Frieden!“ Vielleicht hörte mich der Dunkle und empfand etwas Gnade für die unschuldige Seele meiner Schwester. Wie sagte man so schön: Die Hoffnung starb zuletzt.
„Um der Götter Willen, was tut sie da?“, hallte die durchdringende Stimme erneut durch den Raum. Es hörte sich wichtig an. Er hörte sich wichtig an. Und die Stimme schien mir von ausserhalb der Wände der Hütte zu stammen.
„Keine Ahnung, aber es ist äusserst vergnüglich“, sagte ein anderer.
„Da stimme ich zu.“ Wieder ein anderer. Die Stimmen hielten inne und meine Konzentration fiel auf Fredi, welche direkt im Türrahmen zum Schlafraum stand und mich panisch anschaute.
„Rjna du musst hier weg!“, schrie sie.
„Wie lange ist sie schon hier?“, erkundigte sich die eine durchdringende Stimme.
„Das ist das Mädchen, das ich nach dem Überfall auf das kleine Bauerndorf als Blutsklavin beansprucht habe. Vor drei Jahren“, beantwortete ein anderer die Frage.
„Nun, dann wundert mich ihr Geisteszustand wenig. Wie lange liegt sie schon in diesem Fieber?“
„Eine Weile. Sicher etwa zwei Monde“, sagte jemand anderes.
„Dass sie noch lebt …“, hauchte es verblüfft.
„Das schon, rein körperlich gesehen. Ihr Geist hat das aber offensichtlich nicht mitgemacht“, stellte jemand anderes fest.
„Erlöst sie von ihrem Leid. Das ist ja nicht mehr mitanzusehen“, sagte die durchdringende Stimme herablassend.
„Bei allem Respekt, aber das ist nicht in Eurer Entscheidungsgewalt. Ihr seid unser Anführer, aber sie ist meine Sklavin!“
Weiter kam ich nicht mehr mit. Ich verstand sowieso nur bruchstückhaft, was sie von sich gaben, und das Ganze wurde mir bald zu blöd. Vater war verschwunden, mitsamt Frederike. Ich wusste nicht, wo sie hin waren, aber ich war auch viel zu müde, um mir darüber noch Gedanken zu machen. Mein nackter Körper glitt an der Wand hinab und blieb regungslos auf dem Boden liegen. Unweigerlich schlossen sich meine Augenlider und liessen mir keine andere Wahl, als dem Sog in die Traumwelt nachzugeben.

















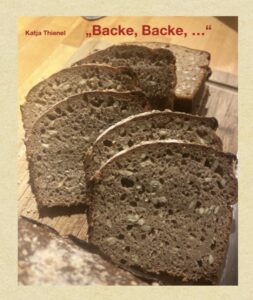






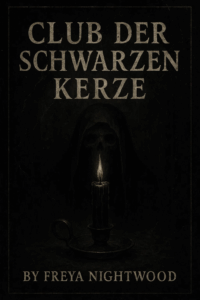







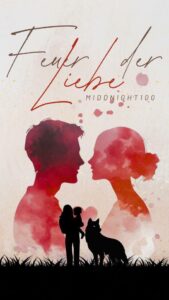
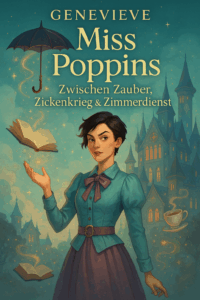

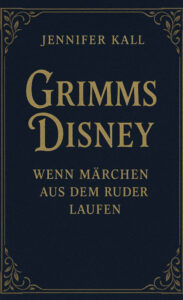


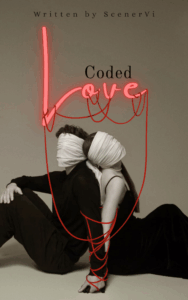

Kommentare