05. Semesterbeginn


Kaum zu glauben, dass dieser Wald noch Hamburger Stadtgebiet sein soll! Es ist so einsam, dass ich mich genauso gut im Harz oder Elm befinden könnte, auf einer jener ausgedehnten Wochenendtouren, wie ich sie früher so oft unternommen habe.
Sabine habe ich längst wieder aus den Augen verloren. Aber sie ist bestimmt noch vor mir und folgt den weißen Kreuzen am Wegrand. Wie ich.
***
Das erste Semester in Mittenwerda begann. Tatsächlich erinnerte hier vieles an die Schule: der feste Stundenplan, die strikte Einordnung der Studenten in Jahrgänge, die in der Regel bis zum Diplom zusammenblieben, und schließlich das Selbstverständnis der Dozenten, nicht in erster Linie gute Fachwissenschaftler sein zu wollen, sondern auch und vor allem Wissensvermittler, Lehrer. Sie waren aufrichtig bemüht, in uns ein grundlegendes Verständnis für ihr Fachgebiet zu erzeugen. Welch ein Unterschied zu meiner alten Hochschule, wo die Profs oft nur pflichtschuldig und gelangweilt von der Kanzel herab doziert hatten!
Der Studienbetrieb wurde in den unterschiedlichsten Formen abgehalten, von denen Vorlesungen und Seminare bloß zwei waren. Oft arbeitete man im Rahmen von Projekten an Themen, zudem es gab zahlreiche Praktika. Diese fanden anfangs noch innerhalb der Fachhochschule statt, sollten später aber in Unternehmen oder Behörden durchgeführt werden.
In Mittenwerda interessierten sich die Dozenten zum ersten Mal dafür, was man an Grundlagen für das Studium mitbrachte. Es zeigte sich, dass mir viele der anfänglichen Studieninhalte schon von meiner Beschäftigung mit dem Computer her bekannt waren. So hatte ich mir neben der Programmierung, ohne es zu ahnen, bereits wichtiges Basiswissen für Logistik und Geschäftsprozessmanagement erarbeitet.
In diesem Klima blühte ich auf. Zum ersten Mal brachte mir Lernen Spaß. Plötzlich gehörte ich zu den Guten, denjenigen, die es „drauf“ hatten. Ich konnte es kaum fassen.
Das Herumirren in labyrinthischen Betonbunkern, das für mich bislang den Uni-Alltag symbolisiert hatte, gehörte nun der Vergangenheit an. Die Seminargebäude waren klein und übersichtlich und lagen nie weit voneinander entfernt.
Auch zum Wohnheim war es nur ein Katzensprung. Wir Informatiker brauchten aus unserem Fachbereichsgebäude sogar nur über den „Schulhof“ zu gehen und hatten schon das Quarrée erreicht, das eine Handvoll dreistöckiger Wohnheimgebäude bildeten. Zurzeit wurden die Häuser renoviert, eines nach dem anderen. Mein Haus war das letzte, das sich noch in seinem alten, hinfälligen Zustand befand, daher die günstige Miete. Es war interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Ossis und die wenigen Wessis, die außer mir hier wohnten, mit dieser Situation umgingen. Die Wessis hatten an allem etwas auszusetzen. Sie fluchten über die einfach verglasten, zugigen Fenster, monierten die verkalkten Klos und Waschbecken, störten sich an den rostigen Armaturen, den altersschwachen Möbeln und Gerätschaften, der maroden Hauselektrik. Die Studenten aus dem Osten hingegen fügten sich ohne großes Murren in die gegebenen Umstände.
Und seltsam: Auch mir, der ich doch in einigem Wohlstand aufgewachsen war, genügte völlig, was ich an meinem Zimmer hatte. Das Baufällige, Improvisierte des Wohnheims lag mir irgendwie. Ich fand es geradezu befreiend, endlich der Rundum-Sorglos-Situation entronnen zu sein, die ich von klein auf gewohnt gewesen war.
Überhaupt schien mir der Osten viel näher und vertrauter zu sein, als es meine Heimat je gewesen war. Vielleicht war das der Grund, weshalb ich in Mittenwerda zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Interesse am Gemeinschaftsleben entwickelte. Gleich in den ersten Tagen kam ich mit Christoph und Rico ins Gespräch, meinen unmittelbaren Zimmernachbarn zur Rechten und Linken. Christoph hielt ich zuerst für einen Dozenten. Er war jenseits der 30 und hatte sich erst jetzt zu einem Sozialpädagogik-Studium entschlossen. Seine gemütliche Art erinnerte ein wenig an Professor Spengler. Wie ich stammte er aus dem Westen. Bei Rico hingegen verriet schon der Name den Ossi. Er war Fußballer und hatte angeblich ernsthafte Aussichten auf eine Profikarriere. Aber zunächst wollte er ein „ordentliches Studium hinlegen“, wie er in breitestem Sächsisch erläuterte. Er war für BWL eingeschrieben.
Nach und nach entstand ein kleiner Kreis von Leuten. Auch René gesellte sich in dieser Zeit zu uns. Er studierte E-Technik und kam aus der näheren Umgebung von Mittenwerda. Für mich war er ein typischer Vertreter des grundsoliden, herzensehrlichen Ossis ohne Allüren und Eitelkeiten.
Was unternahm man in einer Kleinstadt wie Mittenwerda? Es gab hier fast keine Kneipen und Clubs, abends waren die Straßen der Innenstadt wie ausgestorben. Studentisches Flair suchte man vergebens.
Man traf sich im Wohnheim, zum Quatschen und gemeinsamen Kochen. Oder man ging zusammen in die „Filmbühne“, Mittenwerdas einziges Kino. Einige Kilometer außerhalb fand sich der „Grüne Hund“, ein alter Dorfkrug, den ein mutiger Gastronom nach der Wende in eine Musikkneipe verwandelt hatte. Anfangs war dort wohl so gut wie nichts los gewesen. Aber nach und nach hatte sich die Existenz des Grünen Hundes herumgesprochen, immer mehr Leute waren gekommen. Inzwischen lief es bestens. Der große, fast unverändert belassene Gastraum war fast jeden Abend voll, nur saßen dort jetzt keine Landwirte mehr, sondern fast ausschließlich junge Leute aus der Region. In einer angrenzenden, ehemaligen Scheune wurde am Wochenende getanzt, auch fanden hier zahlreiche Konzerte statt.
Einen bedeutenden Nachteil hatte der Grüne Hund: Man kam nur schlecht hin. Zu Fuß war es zu weit, eine Busverbindung gab es nicht. Wenn man mit dem Auto fuhr, konnte man nichts trinken. Also nahmen wir meistens das Rad.
Und schließlich gab es in Mittenwerda die Gartenstadt. Sie lag nicht weit entfernt von Hochschule und Wohnheim, in Richtung des Bahnhofs, und bildete eine kleine Welt für sich. Die niedrigen Reihenhausblöcke des Viertels waren zur Jahrhundertwende für die Bediensteten der Hochschule errichtet worden. Aber schon zu DDR-Zeiten war ein Großteil der Bausubstanz verfallen. Nach der Wende hatten viele der Alteinwohner das Weite gesucht, und Studenten waren an ihre Stelle getreten, Künstler und „zwielichtiges Volk“, wie es hieß. Jetzt gab es hier überwiegend WG’s, Kommunen und andere, zum Teil recht exotische Wohnprojekte.
Die Gartenstadt war wie geschaffen für die zahlreichen Feten und Picknicks, die zu Semesterbeginn stattfanden. Jedes Haus hatte eine geräumige Terrasse, die sich zum Grillen anbot. Hinzu kam das großartige Wetter. Bis in den Oktober hinein blieb es warm, auch abends konnte man sich lange im Freien aufhalten. Und so schien eine Gartenparty auf die nächste zu folgen. Als es schließlich zu kalt wurde, verlagerte sich das Geschehen kurzerhand in die geräumigen Wohnzimmer. Gerade wir Neuen waren wie berauscht von der ungewohnten Freiheit, die der Auszug von zu Hause mit sich gebracht hatte. Alles schien zu passen, fügte sich harmonisch und leicht ineinander. Wie im Traum.
Es muss in dieser Zeit gewesen sein, da ich Katja und Sabine kennenlernte. War es bei einem der besagten Grillfeste? Oder war es auf der Einweihungsparty, die die beiden selbst gaben? Denn sie wohnten zusammen in einer der Gartenstadt-WG’s. Von Beginn an hatten mich die ungleichen Schwestern interessiert.
Wie ich gehörten sie zur seltenen Spezies der Wessis, die sich zum Studieren in den „Wilden Osten“ aufgemacht hatten. Sie kamen von der Küste, aus einer kleinen Stadt an der Ostsee in der Nähe von Kiel. Sabine studierte bereits seit einem Jahr in Mittenwerda. Zu Beginn des Wintersemesters war das Zimmer ihrer Mitbewohnerin freigeworden, und kurzentschlossen war Katja, die sich ebenfalls für Mittenwerda entschieden hatte, dort eingezogen.
Katja wirkte auf den ersten Blick unauffällig und zurückhaltend, fast schüchtern. Als ich noch nicht viel über sie wusste, hatte ich das Gefühl, man müsse ihr jede Schwierigkeit abnehmen, sie vor des Lebens Unbilden beschützen. Aber rasch stellte sie sich als sehr resolut und zupackend heraus. Vor dem Studium hatte sie einige Zeit in einer Autowerkstatt gejobbt und wollte das in den Semesterferien weiterhin tun, um sich einige Extragroschen zu verdienen. Sie studierte BWL, und anfangs hatten wir viele gemeinsame Lehrveranstaltungen.
Sabine war ein ganz anderer Typ: extrovertiert, laut, immer vorn dabei. Vehement vertrat sie ihre Ansichten und setzte sich meistens durch. Man hatte Respekt vor ihr. Die Zeit des Studiums wollte sie voll auskosten, sie wollte feiern, Spaß haben. Aber auch das politische Engagement kam nicht zu kurz. Die Region um Mittenwerda galt als rechtsradikale Hochburg, und Sabine war Aktivistin in der lokalen Antifa. Als eine der wenigen in meinem Bekanntenkreis setzte sie sich mit diesem Thema auseinander, nahm an Kundgebungen teil, veranstaltete Infoabende. Ich bewunderte insgeheim ihren Mut. Gleichzeitig fand ich sie manchmal anstrengend. Wer sich nicht eindeutig links äußerte, war bei ihr schnell unten durch. Ihr Studienfach nannte sich „Soziale Arbeit“, was mir nicht viel sagte.
Trotz aller äußerlichen Unterschiede – die zurückhaltende Katja, unscheinbar gekleidet, mit dunkelblondem, unauffälligem Haar, neben der lauten, offensiven Sabine mit ihren bunten, alternativen Klamotten und dem strohgelb leuchtenden Haarschopf – erkannte man bei genauerem Hinsehen die Verwandtschaft zwischen den beiden. Sie hatten die gleichen blaugrauen Augen, die ihr Gegenüber neugierig und zugleich scheu musterten. Und beider Schwestern Gesichtsausdruck bekam im Halbprofil diesen Hauch ins Melancholische, fast Traurige. Wenn man eine der beiden länger betrachtete, vergaß man fast, wen man vor sich hatte: Katja oder Sabine.
***
Wieder frage ich mich, ob ich noch in Hamburg bin oder unbemerkt, durch eine Störung im Raum-Zeit-Gefüge, in eine fremde Wildnis versetzt wurde. Der Weg durch den Wald hat sich zu einem Berg-und-Tal-Parcours entwickelt, wie man ihn im Harz nicht beeindruckender vorfände. Ich bin außer Atem, Schweiß steht mir auf der Stirn. Wie lange ist es her, dass ich eine Wanderung dieser Art unternommen habe?
Das Blätterdach der Bäume lichtet sich bereits, an vielen Stellen scheint der Himmel durch. Zwischen den Stämmen sieht man Spinnenfäden im Sonnenlicht glänzen.
Offenbar nähern wir uns nun einem belebten Ort. Stimmengewirr ist zu hören, das langsam lauter wird. Ich sende ein heimliches Stoßgebet in den Äther, dass unser Weg seine Richtung ändern, von der Geräuschquelle wegführen möge. Vergebens. Der Lärm steigert sich immer weiter, bis schließlich ein großes Gebäude zwischen den Bäumen auftaucht.
Es ist ein Ausflugslokal mit einem weitläufigen Biergarten an seiner Rückseite. Gäste sitzen dicht gedrängt an langen Holztischen, essen und trinken, genießen den vielleicht letzten warmen Tag des Jahres. Als ich an ihnen vorübergehe, fühle ich mich, als käme ich geradewegs aus der Wildnis. Ein Waldschrat, der sich in die Zivilisation verirrt hat.
Der Weg führt um das Lokal herum. An der Vorderseite des Hauses liegt eine breite Veranda, die ebenfalls bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Zahlreiche Spaziergänger kommen mir entgegen, auf einer schmalen Pflasterstraße rumpeln Familienkombis an mir vorüber. Die Straße endet an einem Wendekreis, wo ein Linienbus wartet.
Sabine und ihr Hund haben sich bereits durch die Flut von Ausflüglern gearbeitet und biegen auf einen neuen Weg ein. Ich folge ihnen. Auf einem Baum am Wegesrand ist das nächste Kreuz zu sehen. Wir befinden uns also noch immer auf demselben Wanderweg. Durch die Markierungen scheint ein heimlicher Kontakt zwischen uns entstanden zu sein, eine Verbindung, die mich immer weiter in alte Zeiten zurückführt…
***
Die Lehrveranstaltungen wurden immer spannender. Alles interessierte mich, von der Mathematik über die Informatik bis zu den Wirtschaftswissenschaften. Ich wollte die Dinge grundlegend verstehen, sie ganz und gar durchdringen und im Zweifel kritisch hinterfragen. Als zum Beispiel in der Mathe-Vorlesung der Begriff der unendlichen Menge eingeführt wurde, bemerkte ich als Einziger den Widerspruch. „Menge“ als etwas Abgeschlossenes, Ganzes in einem Zug mit „unendlich“, dem Inbegriff des Unfertigen – das konnte nicht korrekt sein. Ich reklamierte meine Bedenken. Der Dozent lieh mir daraufhin einen schmalen Band über die Arbeiten von Cantor, dem Begründer der modernen Mengentheorie. Unter großen Mühen arbeitete mich durch die sehr abstrakten Darlegungen und begriff schemenhaft, dass unter bestimmten Voraussetzungen so etwas wie eine „unendliche Ganzheit“ denkbar ist. Ich war fasziniert: Auch scheinbar absolute Dinge wie „Unendlichkeit“ ließen sich also hinterfragen und in ihrer Bedeutung weiterentwickeln.
Die Profs, sichtlich dankbar für mein Interesse an ihrer Materie, begannen mich immer stärker zu fördern. Nie zuvor habe ich so viel Zuspruch und Ermutigung erfahren wie in Mittenwerda. Das Studium bekam einen geradezu sinnstiftenden Charakter für mich. Klausuren-Punkte und Scheine spielten dabei nur eine untergeordnete Rolle, es ging mir ums Lernen an sich, ums Erweitern meines Horizonts. Dementsprechend hoch war mein Einsatz. Immer mehr Energie wurde in die Hochschule investiert.
Gleichzeitig hatte ich den Anspruch, keine der zahlreichen Freizeitaktivitäten zu versäumen, die in dieser Phase stattfanden. Der Kontakt zum sozialen Geschehen, den ich gerade erst hergestellt hatte, sollte nicht schon wieder abreißen. Ich versuchte, Lernen und Leben unter einen Hut zu bekommen, aber das war ein anstrengendes Unterfangen. Das mich schon bald überforderte.
Zuerst merkte ich beim Sport, dass etwas nicht stimmte. Ich spielte Basketball, und wir trainierten wöchentlich in der Hochschulsporthalle. Dass ich überhaupt Sport trieb, war erstaunlich genug. Und dann machte es noch richtig Spaß. Ich konnte leidlich mithalten, trotz meiner durchschnittlichen Größe und der Schnelligkeit des Spiels, der vielen, kurzen Pässe und verwirrenden Dribblings.
Aber bald zog ich in den Zweikämpfen oft den Kürzeren. Ich war zu langsam, mein Gegner spielte mich aus, rannte mir weg. Irgendetwas war mir in die Knochen gefahren, eine seltsame Erschöpfung ergriff immer stärker von mir Besitz. Ich fühlte mich schwerfällig, kraftlos, überfordert. Als liefe ich nur noch auf Reserve.
Dann war da noch eine andere Sache, die mir langsam unheimlich wurde. Zu vielen Vorlesungen gab es so genannte Übungsgruppen, in denen man, angeleitet von wissenschaftlichen Assistenten oder Studenten höherer Semester, das Gehörte nachbereitete. Mochte es nun Zufall sein oder nicht: Fast alle dieser Übungen hatte ich mit Katja zusammen. Auch während der Projektphasen fand ich mich oft mit ihr im selben Team wieder.
Eines Abends gab es ein Kennenlern-Treffen der Übungsgruppe „Einführung in die Wirtschaftswissenschaften“ bei einer Kommilitonin zu Hause. Auch Katja und ich nahmen teil. Wenn ich heute die Bilder dieses Abends an mir vorüberziehen lasse, kann ich mich an keine Szene erinnern, in der nicht Katja irgendwo in meiner Nähe war. Sogar die Radfahrt zurück in die Stadt machten wir gemeinsam. Wir trennten uns erst auf dem letzten Stück. Sie musste weiter in die Gartenstadt, ich fuhr hinauf zum Wohnheim am Schwanenpark.
Warum überraschte es mich so, dass sie meine Nähe suchte? Dass etwas Derartiges passieren würde, war doch eigentlich zu erwarten gewesen. Und wollte ich es nicht selbst? Von Beginn an hatte ich Katja gemocht.
Aber es konnte nicht sein, war absurd, undenkbar! Diese Dinge hatte ich lange hinter mir gelassen. Jetzt wieder damit anzufangen würde alles durcheinanderbringen, was ich mir zwischenzeitlich aufgebaut hatte. Und am Ende würde ich wieder mit leeren Händen dastehen. Ich verbot mir schlicht, noch weiter darüber nachzudenken.




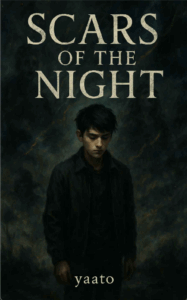














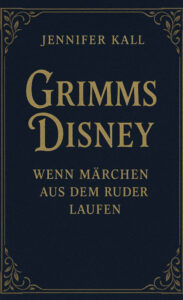

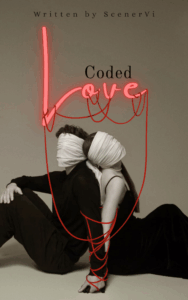













Kommentare