09. Komplett abgetaucht


Die Semesterferien begannen. Ich blieb als einer der wenigen Studenten in Mittenwerda. Weder fuhr ich nach Hause, wie viele Kommilitonen, noch in Urlaub. Für Letzteres fehlte mir das nötige Kleingeld. Aber dieser Verzicht fiel mir noch am leichtesten.
Was das Verreisen anging, war ich seit langem Abstinenzler. Die Begeisterung meiner Altersgenossen fürs Weltenbummeln hatte ich eh nie nachvollziehen können, und auch die Zeit meiner eigenen Expeditionen lag weit zurück. Inzwischen erfüllte mich der Gedanke, allein durch irgendwelche Wälder zu streifen, nur noch mit Gruseln. Ich vermied jeden Ortswechsel; nur die gewohnte Umgebung gab mir Sicherheit, sie war wie ein Geländer, an dem ich mich durchs Leben hangelte.
Und so wurde es ein ereignisarmer, monotoner Sommer. Keine Lehrveranstaltungen, keine Herausforderungen, nichts, das mich zur Aktivität reizte. Wenn wenigstens das Wetter mies gewesen wäre; dann hätte ich mich ohne schlechtes Gewissen in meine Wohnung verkriechen können. Aber die Sonne brannte unaufhörlich, als gönnte sie mir mein inneres Exil nicht, als wollte sie mich hinaustreiben. Mehrmals brach ich zu einer Radtour ins Umland auf, aber jedes Mal ließen Hitze und mangelnde Motivation mich scheitern. Schließlich machte ich es mir zur Gewohnheit, nachmittags an den nahegelegenen Stausee zu fahren. Dort gab es eine Badeanstalt.
In der bei diesem Wetter natürlich Hochbetrieb herrschte. In Wassernähe lagen die Leute immer wie die Sardinen. Je weiter man sich aber vom Seeufer wegbewegte, desto mehr lichteten sich die Reihen. Ganz am Rand der Anlage schließlich, wo das Gelände bereits anstieg, war man in der Regel fast allein. Eine Reihe hoch gewachsener Pappeln spendete Schutz vor der Sonne; hier breitete ich am liebsten meine Decke aus. Ich legte Buch und Wasserflasche bereit und ließ mich nieder. Der Blick von meinem Platz war wunderschön, er ging weit über die sonnenglänzende Wasserfläche des Stausees und das jenseitige Ufer, das von dichtem Wald gesäumt war. Dahinter lagen einsame, still heranreifende Kornfelder, die sich in der Ferne verloren.
Ich verbrachte den Tag lesend und faulenzend. Manchmal ertappte ich mich, wie ich das bunte, sorglose Treiben beobachtete, das sich auf den Rasenflächen der Badeanstalt abspielte. Ein Gefühl unbestimmter Sehnsucht und Traurigkeit hatte sich eingestellt. Suchend und tastend ging mein Blick umher, und auch wenn ich es mir nicht eingestand: Es war vor allem eine Gestalt, die ich in der Menge zu entdecken hoffte, ein Gesicht mit einem bestimmten Paar blaugrauer Augen. Ich wurde nie fündig. So viele Menschen waren hier – nur der eine fehlte…
Nie begegnete ich in diesem Sommer Bekannten. Alle waren nach Hause gefahren. Oder verreist, in blaue Fernen, an die See.
***
Als die Lehrveranstaltungen wieder begannen, war es für mich wie eine Erlösung. Wahrscheinlich war ich der einzige Student Mittenwerdas, der es so empfand. Aber es tat auch gut, nach so langer Zeit endlich die Kommilitonen wiederzusehen. Ich nahm an diversen Begrüßungstreffen teil, im Wohnheim und in der Gartenstadt. Sogar in den Grünen Hund ging ich einmal mit.
An einem Samstagnachmittag Anfang Oktober waren wir alle bei Katja eingeladen. Sie hatte in den Ferien Geburtstag gehabt und gab nachträglich eine Gartenparty. Es war ein wunderschöner Herbsttag, ganz ähnlich dem heutigen. Keine Wolke stand am hohen, pastellfarbenen Himmel, die Luft war trocken und klar. Man konnte weit übers Land blicken; nur am äußersten Horizont zeigte sich feiner Dunst. Im Sonnenschein heizte es sich noch sommerlich auf, im Schatten dagegen spürte man bereits die herbstliche Kühle.
Die im Garten aufgebauten Tapeziertische bogen sich unter der Last der Speisen. Katja musste tagelang gekocht, gebacken und zubereitet haben. Entstandene Lücken im Buffet wurden sofort wieder aufgefüllt. Die Reserven schienen unerschöpflich. Man konnte kaum aufhören zu essen.
Sabine war nicht da. Sie nahm mit ihrer Antifagruppe an einer Demo irgendwo im tiefsten Brandenburg teil. Katja machte sich Sorgen, dass etwas passieren könnte – wohl zu Recht. Ich jedoch atmete insgeheim auf.
Trotzdem fühlte ich mich zwischen den Gästen seltsam fremd und bindungslos. Vielleicht lag es an meiner erst kürzlich überstandenen Erkältung. Ich hatte einige Tage flachgelegen und war wohl noch nicht wieder richtig gesund.
Alle erzählten von ihren Unternehmungen während der Ferien. Von Reisen, Abenteuern, Expeditionen ins Unbekannte. So jedenfalls klang es in meinen Ohren. Und immer wieder war die Kanu-Tour Gegenstand des Gesprächs.
Die Kanu-Tour… ich hatte gehofft, dass inzwischen niemand mehr darüber sprechen würde. Immerhin lag das Ereignis schon mehr als zwei Monate zurück. Aber die Eindrücke der Fahrt schienen noch immer nachzuwirken.
Die Tour war von einigen Leuten aus unserer Erstsemester-Clique geplant und organisiert worden. Per Kanu hatte es drei Tage auf dem Fluss in Richtung Norden bis zur Elbe gehen sollen, mit Proviant und Zelten.
Natürlich war auch ich gefragt worden, ob ich mitkäme. Anfangs war ich versucht gewesen, zuzusagen, aber nach ein paar Tagen überwogen die Bedenken. Bei meinen eigenen Expeditionen früherer Tage war ich immer allein gewesen. Wie sollte ich die Enge eines Dreimannzeltes aushalten? Und was wäre, wenn es die ganze Zeit regnete? Ich wusste nur zu gut, wie stark schlechtes Wetter auf die Stimmung drückt. Eine Gruppe würde das nicht überstehen, dessen war ich mir sicher.
Schließlich sagte ich ab. Schweren Herzens zwar, aber ich kannte meine Grenzen.
Außer mir hatten fast alle an der Fahrt teilgenommen und offenbar viel Spaß gehabt. Es schien wirklich alles gepasst zu haben: eine schöne Route, ruhige Campingplätze, gute Stimmung in der Truppe. Und nicht ein Regentropfen war gefallen. Kein Wunder, bei dem Supersommer, den wir gehabt hatten. „Jahrhundertsommer“ wurde er mittlerweile in den Medien genannt…
Wenn ich berichten sollte, wie ich die Zeit zugebracht hatte, antwortete ich stets ausweichend. Erzählte von „Nach-Hause-fahren“, „Ausflügen“ und ähnlichem. Plötzlich war es mir peinlich, wie passiv und ideenlos ich die Zeit hatte verstreichen lassen, immer auf den Semesterbeginn wartend.
Je länger die Party dauerte, desto deutlicher wurde es, dass ich nicht mehr dazugehörte. Ich war raus, war ein Fremder unter lauter guten Freunden.
Am späten Nachmittag verschwand die Sonne. Auch wenn es nicht wirklich kalt wurde, lief mir immer wieder ein seltsames Frösteln über den Rücken. Meine Erkältung war wohl zurückgekehrt. Ich beschloss zu gehen.
Mein Blick suchte Katja und fand sie zunächst nirgends. Schließlich entdeckte ich sie, kauernd neben der Terrassentür, wo sie sich einen letzten Streifen Sonne ins Gesicht scheinen ließ. Sie hatte die Augen geschlossen und sah erschöpft aus. Dennoch wirkte sie zufrieden.
Sie hörte mich kommen. Als sie die Augen öffnete, lag ein merkwürdiges Glänzen in ihnen. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich der Erste war, der ihre Party verließ. „Ich will los“, zwang ich mich zu sagen. Meine Stimme war auf einmal merkwürdig belegt. „Bin noch nicht wieder fit“, fügte ich entschuldigend hinzu. Ich spürte eine Kloß im Hals, etwas schnitt mir wie mit Rasierklingen in die Magengrube…
Dann hatte ich mich wieder im Griff. „Danke für die Einladung“, sagte ich mit fester Stimme, „du hast dir wirklich viel Mühe gemacht.“
Wortlos schaute sie zu mir nach oben. Das schräg einfallende Sonnenlicht ließ ihre Pupillen aufleuchten wie zwei große Diamanten. Sie wanderten hin und her, als würden sie mich abtasten, etwas in mir suchen.
Schließlich wurde ihr Blick ganz ruhig. Aber ich glaubte jetzt so etwas wie Resignation darin zu erkennen, einen stillen Abschied…
Auf dem Weg nach Hause sah ich immer wieder diese Augen vor mir. Mit jedem Kilometer, den ich zurücklegte, vergrößerte sich meine Traurigkeit. Alles in mir wollte umdrehen, zum Gartenfest zurückkehren. Und doch konnte ich nicht. Es stand nicht in meiner Macht.
Ich fühlte mich wie damals, als ich aus der Jahn-Siedlung vertrieben worden war.
***
Von nun an wurden meine Kontakte zu Rico, Christoph, René und den anderen aus der Erstsemester-Clique immer spärlicher. Schließlich kam ich nur noch zu den Lehrveranstaltungen mit anderen Kommilitonen zusammen. Man hielt gemeinsam Referate, bildete Arbeitsgruppen, Projektteams, versuchte sich in Übungsgruppen an den gestellten Aufgaben – der übliche Studienbetrieb.
Sämtliche Energie, derer ich habhaft werden konnte, investierte ich jetzt ins Studium. Und tatsächlich gelang es mir, mein Anfangsniveau nicht nur zu halten, sondern im Gegenteil zu steigern. Die Konzentration aller Kräfte machte es möglich.
Immer schneller schienen die einzelnen Semester zu verstreichen. Die Anforderungen wuchsen exponentiell, gab keine Verschnaufpausen mehr, keine Erholung. Auch die Semesterferien waren jetzt stets mit Verpflichtungen angefüllt, nicht mehr so aufgabenlos, so langweilig wie zu Beginn des Studiums. Es galt Hausarbeiten anzufertigen, Projekte durchzuführen, Praktika zu absolvieren.
Letzteres bald auch außerhalb der FH, in verschiedenen Unternehmen in der Region. Ich fand es überaus spannend, die Berufswelt kennenzulernen und dort den Hochschulstoff praktisch anzuwenden. Die Arbeit im Team lag mir allerdings nicht so. Ich beschäftigte mich lieber allein mit einer interessanten Aufgabe und präsentierte den Kollegen anschließend die gefundene Lösung.
Lehrveranstaltungen kamen und gingen. Klausuren und Prüfungen bestand ich fast immer im ersten Anlauf, nichts konnte mich mehr so leicht aus der Bahn werfen. Endlich war ich mir meiner Fähigkeiten sicher. Das war nicht bloß ein Strohfeuer gewesen, wie anfangs befürchtet, sondern schien tatsächlich auf Substanz zu beruhen.
Im Fach Mathematik konnte mir inzwischen nur noch ein Kommilitone das Wasser reichen: Dietmar Pries, der ebenfalls Wirtschaftsinformatik studierte. Ein schräger Typ. Er sah aus wie der Sänger der Ramones und spielte tatsächlich in einer Punk-Band am Schlagzeug. Wo es laute Partys gab, da war Dietmar zu finden; ich glaube, er ist auch am Abend meines Zusammenstoßes mit Sabine dabei gewesen.
Gleichzeitig war er genial. In den Übungsgruppen gab es zwischen uns immer einen unausgesprochenen Wettstreit. Wer schaffte es, die wirklich komplexen Sätze herzuleiten, die abstrakten Beweise zu führen? Bislang war der Ausgang unentschieden. Manchmal erzielte er die besseren Ergebnisse, manchmal ich.
Ich betrachtete Dietmars Konkurrenz stets mit gemischten Gefühlen. Einerseits war er der einzige gleichwertige Gegner weit und breit, und als solcher ein echter Ansporn für mich. Ohne ihn hätte ich bestimmt nicht immer die nötige Disziplin für die Übungsblätter aufgebracht. So aber musste ich mir, wenn ich mit einer Aufgabe nicht weiterkam, nur das drohende Szenario ausmalen: Dietmar präsentierte seine Lösung, während ich mit leeren Händen dasaß. Diese Vorstellung setzte unglaubliche Kräfte frei.
Andererseits wurden mir durch ihn meine eigenen Grenzen aufgezeigt. Ich konnte Sätze herleiten, Lösungsalgorithmen entwickeln, aber sobald das Formale des Vorlesungsstoffs endete und das freie Spiel begann, musste ich passen. Professor Spengler zum Beispiel konfrontierte uns gerne mit Konstellationen aus dem Schach und anderen, einfacheren Strategiespielen, er ließ uns beweisen, welcher der beiden Spieler die Partie zwingend gewinnen oder verlieren musste. Hier war ich meistens überfordert, im Gegensatz zu Dietmar, der bei solchen Aufgaben erst richtig aufblühte.
Letztlich war es wohl gut, dass er da war. Ohne ihn wäre mir der Erfolg wahrscheinlich zu Kopf gestiegen. So blieb ich auf dem Teppich, auch wenn es hart war, von Zeit zu Zeit ausgestochen zu werden.
Mein gutes Verhältnis zu Professor Spengler blieb bestehen. Irgendwie waren wir aus demselben Holz geschnitzt. In der Vorlesung ahnte ich oft schon im Voraus, welche Richtung sein Vortrag nehmen, welche Frage er uns gleich stellen würde. Auch seine gesellschaftlichen Ansichten sprachen mir aus dem Herzen. So verachtete er Studenten, die ihre Ausbildung nur als Karrieresprungbrett ansahen und kein wirkliches Interesse an den Inhalten aufbrachten. Ebenfalls keinen guten Stand bei ihm hatte, wer die Mathematik nicht mit dem nötigen Ernst und Respekt betrachtete.
Wie zum Beispiel Dietmar. Neben aller fachlichen Brillanz ließ er die Welt stets seine Verachtung gegenüber Studienbetrieb, Dozenten und Kommilitonen spüren. Deshalb war er bei Professor Spengler nicht wohlgelitten.
Professor Spengler war es auch, der mir nach dem Vordiplom vorschlug, für das Hauptstudium an eine Universität zu wechseln. Wenigstens solle ich dort im Anschluss an die FH ein Aufbaustudium in Mathe oder Informatik absolvieren, fand er. Auch das Thema Promotion sprach er an. Ich dachte ernsthaft über diese Möglichkeit nach. Andererseits waren da die vielen Unternehmen, die mit Jobs lockten. Sie veranstalteten jedes Jahr eine kleine Karrieremesse auf dem Campus, präsentierten sich dort an Infoständen, standen für Gespräche bereit und boten Praktika an. Qualifizierter Nachwuchs war rar, und natürlich wollten alle die ersten sein, die bei uns die besten Leute abgriffen, sobald diese ihr Diplom in der Tasche hatten. Derart begehrt zu sein, während draußen alle Welt von Arbeitslosigkeit sprach, zumal hier im Osten, schmeichelte dem Ego gehörig, das konnte ich nicht leugnen.
Und doch kamen immer wieder Phasen des Bedenkens. Eine innere Stimme ermahnte mich, das Tempo zu drosseln und Dingen außerhalb des Studiums eine Chance zu geben. Deshalb unternahm ich von Zeit zu Zeit halbherzige Versuche, aus meiner Einsamkeit herauszukommen. Zum Beispiel besuchte ich die verschiedenen Uni-Partys: die Fete der Informatik-Fachschaft, die BWLer-Bambule, die Sommersause und, nicht zu vergessen, das Bergfest unseres Jahrgangs. Meistens verschwand ich nach zwei, drei Stunden gelangweilten Herumstehens wieder. Wirklich ändern taten solche Aktionen an meiner Lage nichts. Sie dienten nur der Gewissensberuhigung.
Ich spürte, dass ich nicht wirklich vorhatte, aus meinem Leistungsprinzip auszubrechen. Dies hätte bedeutet, meine hohen Ziele und Ideale aufzugeben, mich aufs fade Mittelmaß zu beschränken, wie so viele meiner Kommilitonen. Ihnen ging es um Leistungsnachweise, bestandene Prüfungen, einen Abschluss. Für mich hingegen sollte das Studium etwas Großes sein, etwas Besonderes. Ich wollte mich mit elementaren Dingen auseinandersetzen, wollte verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Und selbst wenn ich mich plötzlich eines anderen besinnt hätte: Das Schwungrad, einst unter großen Mühen in Gang gesetzt, ließ sich jetzt nicht mehr stoppen. Es drehte sich immer weiter, aufgrund seiner eigenen Massenträgheit, und riss mich mit. Ich war ihm ausgeliefert.








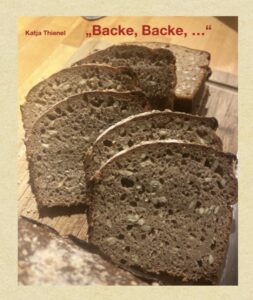












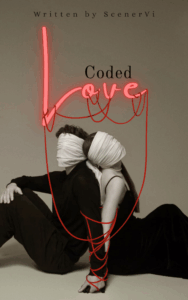





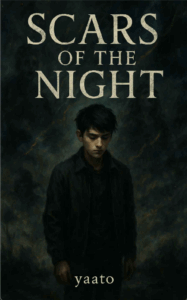












Kommentare