11. Das Dorf


„Ich will heute Gartenmöbel putzen“, verkündete Muttern am nächsten Morgen beim Frühstück. „Hauke, wie sieht’s aus – machst du mit?“
Oje, das roch nach Arbeit! „Kann Henri das nicht übernehmen?“, versuchte ich mich rauszureden.
„Der hat schon so viel geholfen“, fand Muttern.
„Ja, mal gucken.“ Ich machte keinen Hehl aus meiner völligen Bocklosigkeit. Gartenmöbel abschrubben – so ein Mist! Das Zeug hatte garantiert ewig lange im Keller gestanden und musste megadreckig sein. Muttern bohrte erst mal nicht weiter nach, aber die Sache war garantiert noch nicht ausgestanden.
Als ich wieder oben in meinem Zimmer saß, rechnete ich die ganze Zeit mit ihrem Ruf. Völlig genervt guckte ich aus dem Fenster. Das Sturmwetter der letzten Tage hatte sich anscheinend gelegt: keine zerfetzten Wolkengebirge mehr, die über den Himmel jagten, keine peitschenden Böen, keine abrupten Schnee- oder Hagelschauer. Da oben war es nur gleichmäßig grau und still – so konnte es von mir aus bleiben.
Ob man das Fenster auch richtig öffnen konnte, nicht bloß auf Klappe? Ich versuchte es, aber der Hebel an der Seite machte Schwierigkeiten – er war wohl nicht benutzt worden und klemmte. nicht benutzt worden. Endlich gab er seinen Widerstand auf, und der große Fensterflügel schwenkte zitternd nach innen.
Das erste, was man hörte, war Vogelgezwitscher: laut, vielstimmig – und trotzdem sanft und harmonisch. Verwundert beugte ich mich raus, um die Gegend zu überblicken. Das Bild war – anders. Wenn man in der Nordstadt aus dem Fenster guckte, waren da Hauswände und weite, leere Flächen. Grau hieß die vorherrschende Farbe. Hier dagegen war alles grün. Man sah Pflanzen über Pflanzen: Sträucher, Hecken, Stauden, Beete. Und Bäume, teils frisch gepflanzt und noch klein, teils schon hoch gewachsen, mit dicken Stämmen. Einen kurzen Augenblick hatte ich das Gefühl, in ein kleines Paradies zu schauen.
Und obwohl der Frühling noch gar nicht angefangen hatte, spürte man schon Leben in den Pflanzen: Sie wollten endlich sprießen und blühen, nachdem sie so lange im Winterschlaf gelegen hatten. Dazu die Geräusche der Tierwelt: das aufgeregte Zwitschern der Vögel, das Gurren einer Taube gegenüber auf dem Dachfirst, Krähen, die lärmend in einem Pulk über den Himmel zogen, Hundegebell irgendwo in der Nachbarschaft – ein Durcheinander von Lauten, das aber seltsam anrührte.
Die Unruhe der Natur schien auf die Menschen auszustrahlen. In vielen Gärten waren Leute am Arbeiten; sie gruben Beete um, jäteten Unkraut, rechten altes Laub zusammen. Fenster wurden geputzt, Terrassen gefegt, Räder auf Vordermann gebracht. Zwei Häuser weiter stand jemand in Arbeitskleidung auf einer Trittleiter und ölte den Mechanismus der Markise. Ein großes Werkeln hatte eingesetzt, das wie Aufbruch wirkte.
Irgendwo quietschte jetzt eine Fahrradbremse. Wenig später sah man auf dem Weg zwischen den hiesigen Gärten und dem Nachbarblock den Postboten herankommen. Er verteilte seine Briefe und grüßte die Leute mit lautem „Moin“, hielt Klönschnack mit ihnen. Alle duzten sich.
Und da oben hing dieser beruhigte Himmel. Wurde die Wolkendecke nicht allmählich dünner? Wenn das so weiterging, würde bald die Sonne scheinen…
Mir grauste bei dem Gedanken. Sonne, Frühling – normalerweise hieß das rausgehen, Wärme tanken, den Winter austreiben. All das tun, was mir versperrt war. Ich konnte nur hier in meiner Einzelzelle sitzen, aus dem Fenster starren und mich wegträumen. Sonst nichts. Ich war von der Außenwelt abgeschnitten.
***
Nach dem Mittagessen lag ich pappsatt und hundemüde auf dem Bett. Das Fenster stand mittlerweile wieder auf Klappe, draußen zwitscherten die Vögel lauter denn je. Muttern hatte das Thema Gartenmöbel beim Essens nicht mehr angeschnitten – zum Glück!
Als ich schon halb am Einpennen war, kam von der Terrasse lautes Klappern und Rumoren herauf. Was war das jetzt? Legte sie etwa allein los? Klang ganz so. Meine Güte, die war ja gar nicht zu bremsen, dem Lärm nach zu schließen…
Eigentlich hätte ich jetzt aufstehen und runtergehen sollen, um ihr zu helfen. Stattdessen lag ich hier auf der faulen Haut. Nett war das nicht, ich wusste es ja. Und konnte mich trotzdem nicht aufraffen, keine Chance. Irgendwann fielen mir die Augen endgültig zu.
Als ich wieder aufwachte, lag alles im Halbdunkel. Der Raum war so ausgekühlt, dass ich zitterte – es mussten Stunden vergangen sein. Von der Terrasse war kein Geräusch mehr zu hören. Schlaftrunken richtete ich mich auf. Wie spät mochte es sein? Der Wecker war neulich stehengeblieben, und meine Armbanduhr hatte ich verbummelt.
Erst jetzt bemerkte ich den blauen Himmel. Sah, wie das Dach des Nachbarblocks in der Nachmittagssonne leuchtete. Und endlich fiel der Groschen: Der Vorhang aus Wolken und Dunst hatte sich aufgelöst. Es war tatsächlich passiert. Der Frühling hatte angefangen.
Verzweifelt malte ich mir aus, was jetzt in der Nordstadt los sein musste. Die Straßen waren garantiert rappelvoll, keinen hielt es bei diesem Wetter noch in den vier Wänden. Auch Hartmann und ich wären jetzt ziemlich sicher draußen unterwegs gewesen, auf einem Streifzug durchs Viertel. Vielleicht hätten wir auch einen Abstecher runter zur Bahnschiene gemacht, gucken, wen man dort so traf. Tage wie diese waren in der Nordstadt Aufbruch, Neubeginn. Alles konnte passieren, alles war möglich…
Aber ich war nicht in der Nordstadt. Ich war hier.
Frust und Bitterkeit schnürten mir die Kehle zu. Unter Mühen rappelte ich mich hoch, stieg in die Turnschuhe und wankte zur Tür. Im Flur traf mich fast der Schlag: Gleißend hell kam die Sonne durchs Dachfenster, ich war regelrecht geblendet. Zum Glück wurde es auf den Stufen ins Erdgeschoss wieder angenehm dämmrig.
Auf halber Treppe sah ich plötzlich Henri von draußen hereinkommen, einen Stapel Kartons vor sich her schleppend. Ich verkrümelte mich so weit wie möglich in die Ecke; auf einmal war mir mein zerknautschter Zustand verdammt peinlich. Aber zu spät, er hatte mich bereits entdeckt: „Da bist du ja“, rief er ungeduldig. „Los, komm mal raus. Da sind ein paar Mädchen, die wollen dich kennenlernen.“
Mein Gehirn hatte Ladehemmung. Was für Mädchen? Und was wollten die? Mich „kennen lernen“? Was hieß das denn? Wollten sie mit mir quatschen, oder was? Eigentlich hätte ich Henri gern noch ein bisschen ausgefragt, aber der war längst wieder nach draußen verschwunden.
Mit einem Schlag verflüchtigte sich meine Müdigkeit. Ich nahm die letzten Stufen im Laufschritt, stapfte durch die offenstehende Haustür ins pralle Sonnenlicht. Hier vorn war es so heiß, dass die Luft flimmerte – kaum zu glauben, dass ich eben noch vor Kälte geschlottert hatte! Überall tobten Kinder herum, Erwachsene plauschten entspannt miteinander.
Klaus und Henri luden eifrig Sachen aus dem Wagen, Gartengeräte: Harken, Schaufeln, Rechen, auch so einen komischen Reisigbesen, wie ihn Hexen in Kinderfilmen hatten. „Wo sind die denn?“, fragte ich Henri, der gerade zur Hälfte in der Heckklappe verschwunden war, um die Rückbank wieder hochzustellen. Er kam raus und zeigte zur Straßenecke mit dem Zigarettenautomaten. Ein Grüppchen Leute stand dort versammelt; alle glotzten zu uns herüber. „Die da!“
Verdammt, weshalb winkte er ihnen nicht gleich zu? Das war mal wieder typisch! Mit so einem Idioten von Bruder konnte man sich nur blamieren!
Und jetzt? Wieder auf die Bude verdünnisieren? Ich wollte mit den Dorftrotteln hier ja eh nichts zu tun haben. Andererseits: Wenn ich jetzt einen Rückzieher machte, hätte das feige ausgesehen. Es half nichts, ich musste da hin, wenigstens kurz, ein paar Worte mit denen labern. So ein Mist!
Ich holte meine Jacke aus dem Flur. Eigentlich war es warm genug, aber ohne meine Jacke ging ich niemals los. Ich fühlte mich einfach wohler, wenn sie über meiner Schulter hing. „Na, jetzt aber ran, Casanova“, meinte Klaus grinsend und ließ eine große Gartenschere vor mir auf- und zuschnappen. In seinem Mundwinkel steckte eine qualmende Filterlose. „Maul halten“, raunte ich leise. Es kam eine Spur zu hart rüber, aber Klaus nahm es mir nicht übel, im Gegenteil: Sein Grinsen wurde noch breiter. Wahrscheinlich konnte er sich denken, wie ich mich gerade fühlte.
So lässig wie möglich ging ich auf die kleine Gruppe zu. Ich durfte nicht zu schnell werden, nicht zu zielstrebig. Es musste so aussehen, als wäre ich bloß zufällig hier unterwegs, ein kleiner Spaziergang, sonst nichts.
Anscheinend waren sie zu viert: Zwei Mädchen saßen auf dem Kantstein, eine blond, die andere dunkelhaarig, an der Gartenhecke hinter ihnen standen noch ein Typ und seine Freundin Arm in Arm. Dann erkannte ich die Dunkelhaarige: Es war die Süße von neulich! Prompt wurde ich noch nervöser. ‘Mach dir nicht wegen ein paar Landeiern ins Hemd’, sagte ich mir. Leider nützte es nicht viel.
Die beiden Mädchen ließen mich keinen Moment aus den Augen. In der Nordstadt wäre das ein schlechtes Zeichen gewesen. Wenn Weiber einen dort auf diese Weise anglotzten, war das pure Verachtung, sie wollten zeigen, dass sie dich komplett scheiße fanden. Aber Verachtung konnte ich in den Blicken der beiden auf dem Kantstein nicht entdecken. Nur Neugier, unverhohlene Neugier.
Das Herz schlug mir bis zum Hals. Was sollte ich gleich sagen? Wie waren die Leute hier gestrickt? Was kam gut an, was war tabu? Ich hatte absolut keinen Plan, fühlte mich, als wäre ich gerade auf einem fremden Planeten gelandet und sollte mit Aliens Kontakt aufnehmen.
Dann war ich bei dem Grüppchen angekommen. „Hi.“, brachte ich krächzend hervor. Sonst nichts. Wahrscheinlich klang es unglaublich dämlich.
„Hallo“, kam es von den beiden Mädels zurück, ziemlich freundlich, fast herzlich. Wenn meine Begrüßung danebengegangen war, hatten sie es jedenfalls nicht gemerkt. Ohne es zu wollen spürte ich Erleichterung.
Stille kehrte ein, und sofort wurde die Fremdheit stärker denn je. Irgendetwas musste jetzt gesagt werden, unbedingt, egal was…
Die Süße rettete die Situation: „Und ihr seid gerade hergezogen? Ihr Ärmsten!“
Ich atmete auf, war ihr geradezu dankbar für den Einsatz. Im nächsten Moment dachte ich: Wieso wir Ärmsten? Das klang ja fast, als wollte sie sich einschmeicheln. „Wie meinst du das?“, fragte ich und schaffte es nicht, mein Misstrauen zu verbergen.
„Na ja, kannst nicht viel machen hier“, kam prompt ihre Antwort. Es klang null nach Verstellung oder Einschleimerei.
„Hier ist voll tote Hose“, stimmte die Blonde zu.
Ich war ziemlich überrumpelt, hatte eigentlich erwartet, dass sie alles anpreisen und schönreden würden, was hier abging. Dann kam mir ein Gedanke: „Seid ihr auch aus der Stadt hergezogen?“ Das hätte erklärt, warum sie es hier so langweilig fanden.
„Nee, wir sind von hier.“ Die Blonde lächelte vorsichtig. „Vom Dörfli.“
Ich wurde immer konfuser. Sie versuchten anscheinend gar nicht erst, sich zu verteidigen, sondern nannten die Dinge beim Namen und Schluss. Wo gab’s denn so was?
Wieder ratloses Schweigen. Und wieder war es die Süße, der etwas einfiel: „Auf welche Schule kommst du denn? Auch nach Schmölln?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nach Eckhorst. Auf eine Penne, die sich ‚Wilhelm-Gymnasium’ schimpft.“ Für mich klang der Name noch immer schräg, aber keiner der anderen lachte. Wahrscheinlich kannten hier alle diese Schule.
„Und ihr seid in Schmölln?“, fragte ich, heilfroh, dass wir jetzt ein Thema hatten.
Beide Mädchen nickten.
„Wieso kommst du denn nach Eckhorst?“ Die Blonde ließ nicht locker. Sie sprach leise, aber ihre Stimme hatte einen tiefen, durchdringenden Klang. Ich erläuterte den beiden Mutterns Plan: Sie würde mich morgens mitnehmen, damit mir die Fahrt mit dem Schulbus nach Schmölln erspart blieb. „Angeblich soll der ewig brauchen“, meinte ich.
Jetzt nickten beide sehr lebhaft. „Der nimmt echt jede Milchkanne mit!“, rief die Süße. Auch die Blonde winkte ab.
Noch immer machte mich die Art der beiden ziemlich konfus, dieses Ehrliche, Freundliche, Offene. Das musste einfach gespielt sein, irgendeine Taktik, mit der sie mich einlullten, in Sicherheit wiegten. Garantiert ließen sie demnächst die Masken fallen und legten mit ihrer Verarsche los. Zu den Mädchen in der Nordstadt hätte das jedenfalls gepasst. Ich musste wachsam bleiben, durfte nicht zu sehr auf diese Tour einsteigen…
Sie waren beide 15 und gingen in die Neunte am Gymnasium, wie ich. Nur nannten sie es „Obertertia“. Die Blonde hätte glatt aus meiner zukünftigen Klasse in Eckhorst sein können, wo alle wie Kinder aussahen. Sie war ziemlich mager und hatte noch kaum Oberweite. Die Süße machte da schon einen reiferen Eindruck. Aber das lag vor allem an ihren großen Möpsen.
Bald hatte ich alle Bedenken über Bord geworfen, laberte einfach, wie mir der Schnabel gewachsen war, ohne ständig darauf zu achten, ob es cool genug rüberkam. Trotzdem erntete ich nie Gelächter, Hohn oder Spott. Sie hörten mir einfach zu und wollten immer noch mehr wissen. Meinten sie es wirklich ernst? Waren sie tatsächlich so? Oder rannte ich gerade derbe in ihre Falle? Folgte demnächst das böse Erwachen?




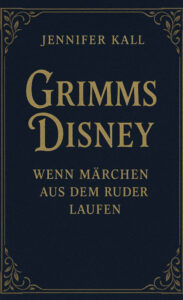




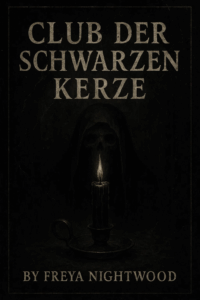



















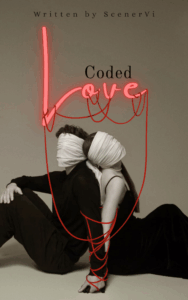





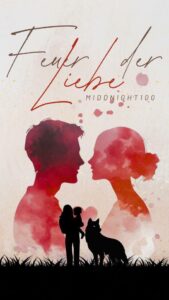







Kommentare