12. Einsam im All


Ziemlich genau ein Jahr später arbeitete ich für meine Frankfurter Firma an einem Softwareprojekt in Kiel. Der Job hielt bislang, was er versprochen hatte: jede Menge interessanter Tätigkeiten und Herausforderungen, agile Kollegen, mit denen es sich gut zusammenarbeiten ließ, Teamleiter, die mich in meinem Tun bestärkten. Und nun wurde mir mit diesem Projekt zum ersten Mal Gelegenheit gegeben, mich selbständig zu profilieren, meinen Wert fürs Unternehmen unter Beweis zu stellen. Kein Wunder, dass ich bis in die Haarspitzen motiviert war.
Nach dem Umzug hatte ich mir vorgenommen, in meiner neuen Heimat Frankfurt einen festen Bekanntenkreis aufzubauen und den „zwischenmenschlichen Aspekt“, wie ich es nannte, nicht mehr zu vernachlässigen. Aber schnell wurde mir klar, dass dies einfacher gesagt als getan war. Meine Firma schickte mich zu Kundenprojekten in alle Winkel der Republik und darüber hinaus. Ich lebte überwiegend in Hotelzimmern; meine Wohnung im Frankfurter Stadtteil Bornheim sah ich höchstens an den Wochenenden.
Und so warf ich fast zwangsläufig alle guten Vorsätze wieder über Bord. Ich konzentrierte mich auf die Arbeit, darüber hinaus gab es nicht viel. Anders gesagt: Alles blieb wie immer, nur dass an die Stelle des Studiums jetzt der Job gerückt war.
Das erste Projekt in Stuttgart, dann eines in Düsseldorf. Jetzt also Kiel. Seit zehn Tagen arbeitete ich hier. Zurzeit fand die „Kieler Woche“ statt. Ich hatte schon von dieser Veranstaltung gehört, sie aber immer für einen reinen Wassersport-Event gehalten. Tatsächlich gab es eine große Segelregatta, aber was der Volksmund als „Kieler Woche“ bezeichnete, war ein riesiges Volksfest. Weite Teile der Innenstadt waren für den Autoverkehr gesperrt, ich kam nur auf Umwegen zu meinem Arbeitsplatz.
Heute nachmittag wollten die Kollegen, in deren Team ich eingesetzt war, zusammen losziehen. Ich war eingeladen, mitzukommen. Eigentlich hatte ich wenig Lust, aber abzusagen hätte natürlich ein schlechtes Licht auf meine Firma geworfen. Jetzt wartete ich, dass es los ging. Ich hatte mich bereits umgezogen, trug jetzt Jeans und T-Shirt, was mir gar nicht recht war. Das Arbeitsoutfit, also Schlips und Kragen, hatte etwas Formales, Unpersönliches und sorgte auf diese Weise für Abstand. Ohne diese Uniform kam ich mir irgendwie schutzlos vor.
Um drei Uhr brachen wir auf. Als erstes machten wir einen Gang über den Rathausplatz, wo ein „Internationaler Markt“ aufgebaut war. Fressbuden aus aller Herren Länder reihten sich aneinander, in den Gassen dazwischen stauten sich die Menschenmassen. Es war ein schwüler Tag, die Sonne brannte herab. Aus Richtung der Straße hörte man immer wieder Martinshörner von Krankenwagen aufheulen. Offenbar versagte so manchem Festbesucher der Kreislauf.
Dann gingen wir in Richtung Schweden-Fähre, die jenseits eines Verkehrskreisels am Hafenpier lag. Nach einem längeren Marsch am Wasser, vorbei an Verladeterminals und alten Speicherhäusern, begann die „Kiel-Linie“. Hier hatten zahllose Segler verschiedenster Größe festgemacht, von der Holzyacht bis zum Viermaster. Viele Schiffe durften betreten werden, auf manchen wurden sogar Getränke ausgeschenkt.
Einen dieser Segler besichtigten wir. Der Skipper erklärte uns die Takelage, die Maschine, berichtete über den Werdegang des Schiffes. Er wurde nicht müde zu erzählen. Wir saßen an Deck, auf Klappstühlen oder den hölzernen Aufbauten, tranken frisch gezapftes Bier und hörten ihm zu. Von der See her wehte ein angenehmer Wind. Der Festlärm drang nur noch gedämpft zu uns herüber, die Menschenschlange, die sich am Ufer entlangwandt, schien sehr weit weg. Ich wäre am liebsten für den Rest der Abends hiergeblieben.
Aber die Kollegen wollten bald weiter. Als wir an Land zurückkehrten und uns gerade wieder ins Getümmel stürzen wollten, hielt irgendetwas mich zurück. Ich ging langsamer, ließ den Abstand zu den Kollegen größer werden. Schließlich sah ich sie in der Menge verschwinden…
Das Alleinsein war wie eine Befreiung. Sollten sie denken, was sie wollten, ich würde mich morgen schon irgendwie herausreden. Ich genoss den Wind, lauschte den Klängen einer akustischen Gitarre, die von irgendwoher heranwehten.
Ein großes Zirkuszelt tauchte auf, in dem gerade ein Konzert stattfand. Drinnen war es brechend voll, auch auf den umliegenden Rasenflächen hatten es sich zahllose Leute bequem gemacht. Die Zeltwände waren hochgerollt, sodass man von überall einen guten Blick auf die Bühne hatte. Die Band wurde frenetisch gefeiert, und ein Zuschauer erklärte mir, es würde sich um die legendären Canned Heat handeln, die bereits in Woodstock aufgetreten sind.
Zum ersten Mal seit langem musste ich an Katja denken. Sie hatte in Mittenwerda öfters von der Kieler Woche geschwärmt, von den vielen Bühnen, die es entlang der Kiel-Linie gab. Plötzlich spürte ich, dass sie in der Nähe war. Bestimmt war sie irgendwo unter den Leuten auf der Rasenfläche, schaute sich ebenfalls die berühmten Canned Heat an. Die vielen Menschen, die ausgelassene Stimmung, die warme Luft – es war wie ein Jahr zuvor, als ich mit Christoph und Rico in Mittenwerda im Schwanenpark gesessen hatte…
Ich ließ ich mich durch die Menge treiben. Was, wenn ich Katja wirklich wiedertraf? Sollte ich doch noch eine Chance erhalten? Diesmal würde ich sie nutzen, dessen war ich mir sicher.
Das Konzert endete bald, aber auf dem Rasen wurde weitergefeiert. Mittlerweile war es dunkel, die Stände an der Kiel-Linie leuchteten grellbunt. Noch hatte ich Katja nicht entdeckt, aber ich wusste, dass ich nur herumzugehen brauchte, um ihr unweigerlich zu begegnen. Spannung lag in der Luft. Über der Innenstadt setzte Wetterleuchten ein, im flackernden Lichtschein zeichneten sich die Gesichter der Menschen ab. Schon glaubte ich Katjas Lachen zu hören. Hoffnung und Wiedersehensfreude breiteten sich in mir aus…
Das Wetterleuchten wurde intensiver. Hinter dem Festlärm war nun unheilvolles Donnergrummeln zu hören. Die ersten Tropfen fielen, kalt und schwer. Plötzlich realisierte ich, dass sich hier gleich alles auflösen würde. Verzweiflung packte mich. Wir waren uns so nah und fanden doch nicht zueinander. Das konnte, durfte nicht sein!
Überall standen die Leute jetzt auf, packten eilig ihre Sachen ein, falteten ihre Decken zusammen, gingen los. Hektik machte sich breit. Wenn ich Katja wenigstens noch einmal sehen könnte, und sei es nur, um die Erinnerung aufzufrischen. Eilig schaute ich mich in alle Richtungen um, wollte die Hoffnung nicht aufgeben, in der zerfallenden, davontreibenden Menschenmasse doch noch das ersehnte Gesicht zu entdecken.
Ein greller Blitz, gefolgt von lautem Donnerkrachen, der Regen wurde zum Wolkenbruch. Ich gab es auf, überließ mich endgültig dem Menschenstrom, der Richtung Innenstadt strebte.
***
In den folgenden Jahren absorbierte die Karriere alle meine Kräfte. Den Vorsatz, Freunde zu finden, schrieb ich jetzt endgültig ab. Die Projekttermine waren hart gesetzt, Zeit war Geld, niemand hatte etwas zu verschenken. Ich musste oft bis in den späten Abend arbeiten und war anschließend viel zu müde, um noch etwas zu unternehmen.
Einige Male gab mein schlechtes Gewissen noch Zuckungen von sich, aber spätestens am nächsten Tag war das wieder vergessen. Das Schwungrad lief und schnurrte, der Sog des Business war unwiderstehlich. Meine Leistung wurde anerkannt, das gab mir genug und füllte manche Lücke.
Fitness war das Einzige, was ich außerhalb des Jobs betrieb. Ich hatte mich in einem Studio angemeldet, das Filialen in ganz Europa unterhielt. So konnte ich auch auf meinen zahlreichen Reiseeinsätzen regelmäßig trainieren. An den Kraftmaschinen und auf dem Laufband baute ich den Stress des Tages ab. Mit einer fast wütenden Leidenschaft und Zähigkeit bearbeitete ich die Geräte. Schade, dass die Energie, die dabei entstand, nicht aufgefangen und genutzt wurde.
Ein paar Jahre später zog ich nach München. Ich arbeitete wieder für ein Consulting-Haus, das seinen Schwerpunkt in der Versicherungsbranche hatte. Schließlich kam ich nach Hamburg. Die hiesige Tätigkeit, so hatte ich es mir vorgenommen, sollte ein großer Karrieresprung für mich werden.
Jahrelang hatte ich im stillen Kämmerlein, sprich: in den abendlichen Hotelzimmern, an einem eigenen Softwaresystem gearbeitet. Ich hatte mein Wissen aus der Diplomarbeit verwendet, meine Berufserfahrungen der letzten Jahre eingebracht. Mittlerweile war das Produkt weit genug gediehen, um bei Kunden eingesetzt zu werden. Und in meinem neuen Unternehmen wollte ich diesen Traum Wirklichkeit werden lassen.
Nach einigem Bohren und diversen Präsentationen konnte ich den Bereichsleiter von meinem System überzeugen. Er holte sich Rückendeckung vom Chef und fand einen Pilotkunden für die Entwicklung eines Prototypen, ein bekanntes Bankhaus in Frankfurt. Es war dasselbe, in dem ich auch mein erstes Praktikum absolviert hatte.
Anfangs klappte alles hervorragend. Tim, Konrad und ich erweiterten meine Basissoftware nach den Vorstellungen des Kunden. Wir arbeiteten Hand in Hand, es lief wie am Schnürchen. Aber dann gewann ein altbekannter Mechanismus bei mir die Oberhand: Ich konnte es nicht ertragen, dass die Kollegen das Projekt nur als eines von vielen ansahen. Für sie war es ein Job, für mich hingegen das Leben. Immer mehr Aufgaben zog ich an jetzt mich, wollte am liebsten alles allein machen. Zudem ließ ich mir aus Frankfurt ständig neue Features aufschwatzen, die ich natürlich ebenfalls perfekt umsetzen wollte.
Die Arbeit wuchs mir über den Kopf. Ich begann mich zu verzetteln, die Fehler häuften sich, beim Kunden kam Verärgerung auf. Die Kommunikation verschlechterte sich zusehends, es gab Missverständnisse auf beiden Seiten, Verdächtigungen, Anschuldigungen. Gleichzeitig erhielt ich immer weniger Rückhalt von meinen Teamkollegen. Kein Wunder, sie waren schließlich kaum noch beteiligt.
Natürlich versuchte ich alles, um das Projekt, mein Projekt, irgendwie zu retten. Ich machte zahllose Überstunden, saß oft bis tief in die Nacht am Rechner und versuchte, dem Chaos Herr zu werden. Aber ich kämpfte auf verlorenem Posten. Die Situation geriet immer mehr außer Kontrolle, ein komplettes Desaster drohte.
Derweil zog meine Firma die Notbremse. Sie schlossen einen Deal mit der Bank in Frankfurt, lieferten ihnen eine moderat angepasste Standardsoftware und wurden im Gegenzug wegen meines gescheiterten Projektes nicht in Regress genommen. All das spielte sich hinter meinem Rücken ab. Ich erfuhr nichts, wunderte mich bloß, dass Tim und Konrad plötzlich abgezogen und mit anderen Aufgaben betraut wurden. Aber die beiden waren für mich sowieso eher eine Last als eine Hilfe gewesen, deshalb fragte ich nicht weiter nach. Dann gingen die Turbulenzen an den Finanzmärkten los, kurze Zeit später wurde ich gefeuert. Erst jetzt setzte mich ein Kollege über den Frankfurter Deal ins Bild. Aber noch immer konnte oder wollte ich nicht kapieren, was eigentlich gelaufen war.
Und nun sitze ich hier am Elbstrand, bin arbeitslos, ohne Geld und Perspektive. Bloß Zeit habe ich auf einmal im Überfluss. Zeit, um nachzudenken… und jetzt wird mir endlich verschiedenes klar.
Ich war schon vor dem Crash längst abgeschrieben, hatte mich als unzuverlässig herausgestellt, als jemand, der seine Grenzen nicht kennt. Solche Leute gefährden den Projekterfolg, sind letztlich ein Risiko fürs gesamte Unternehmen. Sie müssen weg. Die Finanzkrise war nur das Vehikel, um mich loszuwerden, durch sie bot sich unverhofft das Instrument der betriebsbedingten Kündigung. Sie konnten mich geräuschlos entsorgen, ohne selbst Schaden davonzutragen, in Form von Abfindungszahlungen oder etwaiger Rechtsstreitigkeiten.
Warum hätten sie Tim oder Konrad feuern sollen? Die beiden sind zwar nicht die großen Überflieger, aber sie erledigen ihre Aufgaben stets zuverlässig. Bei ihnen weiß man, woran man ist, eigensinnige Aktionen und Eskapaden sind in ihrem Fall nicht zu befürchten.
Und schließlich – ist mein Unternehmen wirklich so stark vom Crash betroffen, wie es zuletzt immer geheißen hat? Das ganze Gerede unter den Kollegen von Abstieg, drohender Pleite und so weiter – sind das womöglich nur Gerüchte gewesen? Hat tatsächlich noch jemand außer mir seinen Job verloren?
Wieder sehe ich mich am Rechner sitzen, der letzte Mitarbeiter im Büro und im ganzen Haus. Vor dem großen Panoramafenster erkennt man die Geschäftshäuser der City Süd mit ihren Fassaden aus Glas und Stahl. Nach und nach gehen in den Türmen die Lichter aus, bis schließlich ringsherum alles dunkel ist. Nur in meinem Raum brennen noch die Neonröhren, senden ihr kaltes Leuchten hinaus in die verlassene Bürostadt.
Wenn ich dort vor meinen Bildschirmen saß, auf meiner Kommandobrücke, einsam durchs All treibend, hatte ich oft das Gefühl, als sei ich vom Rest der Menschheit schlicht vergessen worden.







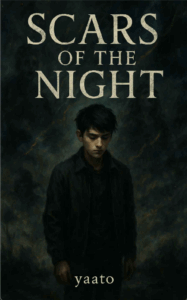


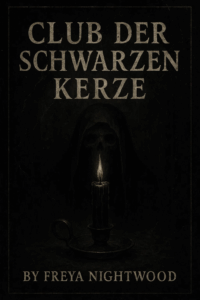















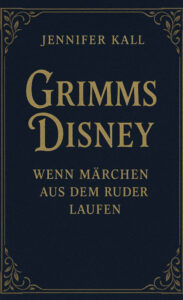








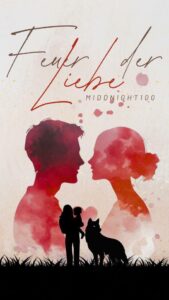




Kommentare