31. Sommer


Das Wetter hielt sich. Blauer Himmel, ein paar Schäfchenwolken, keine Spur von Regen. Die Temperaturen waren inzwischen auf sommerliche Höhen geklettert. Anfangs hatte man abends oft zur Jacke greifen müssen, aber nun konnte man ewig lange in Shorts und T-Shirt draußen bleiben.
Wir trafen uns nach der Schule immer am Telefonkasten. Die Räder waren vollgepackt mit Decken, Proviant und Badesachen. Eine kurze Begrüßung, letzte Neuigkeiten austauschen, ein bisschen über Eltern und Lehrer meckern – dann fuhren wir los. Wir nahmen immer dieselbe Strecke: durch die Schwedenhaus-Siedlung auf die Dorfstraße, vorbei an den Läden und der Feuerwache, schließlich aus dem Ort heraus. Eine Zeitlang konnte man zur Linken noch die Bahnstrecke erkennen, aber hinter einer Wegbiegung verschwanden die Gleise in der Landschaft.
Auf einigen Feldern stand das Korn bereits ziemlich hoch. Die goldgelben Ähren mit ihren langen, seidig glänzenden Fäden erinnerten mich an Marens Haar. „Wintergerste, wird bald geerntet“, erklärte Bernd, als Kristina ihn einmal nach der Getreidesorte fragte. „Aber das meiste hier draußen ist Weizen.“ Er wies auf die umliegenden Hügel, die größtenteils mit etwas überzogen waren, das wie hohes, schilfartiges Gras aussah. Wenn der Wind darüber strich, entstanden Wellenmuster. „Der ist erst Anfang August reif, vielleicht auch schon einen Tick früher, das hängt vom Wetter ab. Auf Gut Neudorf gibt’s dann ordentlich zu tun.“
Steenbarg, der nächste Ort auf unserer Fahrt, bestand nur aus ein paar schmalen Straßen. Seit Ewigkeiten schien hier nicht neu gebaut worden zu sein, man sah nur alte Bauernhäuschen mit Reetdach und Fachwerk. Sätze waren darin eingeschnitzt wie: „Joachim Ewohlt und Trine Ewohlt haben dieses Haus bauen lassen Anno 1793“. Einige der verschnörkelten Inschriften leuchteten in frischem Weiß – die Hausbesitzer hatten sie restauriert. Im Dorf kamen einem häufig Trecker entgegen. Man musste absteigen und sich dicht an die Hauswand pressen, sonst wurde es eng. Die Bauern winkten uns zu und donnerten vorbei, ohne vom Gas zu gehen. Eine Pferdekoppel lag mitten im Ort, es roch nach frischem Heu und Stall. Unter der Dorflinde saß immer ein Grüppchen alter Männer. Wenn wir vorbeifuhren, unterbrachen sie ihren Plausch und grüßen mit lautem „Moin!“ Dann steckten sie die Köpfe wieder zusammen.
Am Ortsausgang passierte man ein rotes „Durchfahrt verboten“-Schild, darunter hing eine kleine Zusatztafel: „Radfahrer erlaubt“. Die Landschaft wurde jetzt bretteben, am Horizont tauchte die grüne Deichlinie auf.
Auf dieser Höhe gab es hinter dem Deich noch einen Streifen Land, der den Launen der offenen See preisgegeben war. Alles schien dort in eine Art Urzustand zurückgefallen: Weite Auen, die das Blau des Himmels widerspiegelten, wechselten sich ab mit grellbunt gesprenkelten Blumenwiesen, Teiche und Tümpel verströmten faulige Gerüche. Eine Infotafel am Wegrand wies das Areal als Vogelbrutgebiet aus. Immer wieder sah man große Schwärme von dort aufsteigen und wie ein zusammenhängendes Ganzes durch die Lüfte kreisen. Es gab abrupte Richtungswechsel, die wildesten Pirouetten wurden vollführt, bis die Wolke sich schließlich wieder herabsenkte und in der Niederung verschwand.
Der Radverkehr wurde nun immer dichter, oft grüßten uns die entgegenkommenden Leute. Ich konnte noch immer nicht unterscheiden, ob es Schönhagener waren oder bloß Urlauber, die auf freundlich machten. Zur Sicherheit grüßte ich jedes Mal artig zurück. Schon von weitem erkannte man, wo sich der Aufgang zum Deich befinden musste – an den vielen abgestellten Fahrrädern. Autos dagegen sah man nirgends, es gab keinen Parkplatz, auch keine Zufahrtsstraße. Und man konnte tatsächlich nichts kaufen, weder Pommes noch Eis, genau wie Bernd erzählt hatte. Zum Glück waren unsere Taschen stets gut gefüllt.
Wir schlossen die Räder zusammen, schulterten das Gepäck und arbeiteten uns gleich einer Karawane den Deich hinauf. Oben blies einem der Wind ungehindert entgegen. Bei diesem Wetter kam er grundsätzlich vom Meer, hatten Jürgen und Bernd erklärt. Richtig stark war er nie, aber doch so lebhaft, dass eine ordentliche Brandung ging und die Wasseroberfläche bis weit hinaus mit Schaumköpfen überzogen war. Beeindruckend fand ich auch die Sicht: Sie war immer extrem klar, der Horizont wirkte wie mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
Die Wachtürme der DLRG suchte man an diesem Strandabschnitt vergebens, genauso die markierten Zonen für Nichtschwimmer – alle mussten auf sich selbst aufpassen. Immerhin hielt ein Stück weiter links eine steinerne Quermole die Wellen ab, dort sah man ältere Leute mit hochgekrempelten Hosenbeinen wassertretend ihre Kreise ziehen.
Viele Frauen waren oben ohne, ein paar Leute lagen sogar komplett nackig in der Sonne, Männlein wie Weiblein. Bei unserem ersten Besuch hatte ich gedacht, an einem FKK-Strand gelandet zu sein und ernsthaft Panik bekommen: Sollte ich mich jetzt ausziehen? Aber dann hatte ich zum Glück auch welche in Badeklamotten entdeckt. Mittlerweile wusste ich, dass es hier alle so hielten, wie sie mochten.
Ein Pfad führte durchs hochgewachsene Gras des Dünengürtels auf den eigentlichen Strand. Zur Begrüßung ließ ich immer den feinen, weißen Sand durch die Zehen rieseln. Oben war er von der Sonne aufgeheizt, aber wenn man sich mit dem Fuß ein Stück hineinarbeitete, wurde er kühl und feucht. Vom Wasser kam das Schreien und Jauchzen der Kinder, die sich übermütig in die heranrollenden Wellen stürzten.
Trotz des guten Wetters war es meist erstaunlich leer – der Steenbarger Strand schien eine Art Geheimtipp zu sein. Verfolgte man dagegen die Wasserlinie in Richtung Schönhagener Strand, wurde das Gewimmel dichter und dichter, bis es schließlich zu einem einzigen, quietschbunten Knäuel verschmolz. Dort hinten spielte er sich also ab, jener Sommertrubel, um den sich hier in der Region so vieles drehte. Ich kannte ihn bisher nur aus der Ferne, aber nichts zog mich hin.
Sturmfluten hatten überall kleine Buchten in die Dünenkante gewühlt; hier fand man problemlos ein windgeschütztes Plätzchen, um das Lager aufzuschlagen. Dann wurde es spannend, denn die Mädchen zeigten beim Umziehen keine falsche Scheu. Zwar drehten sie sich dezent von uns weg, aber sie zogen sich jedes Mal komplett aus, bevor sie in ihre Badeanzüge oder Bikinis schlüpften. Mich brachte das immer völlig durcheinander. Eilig schaute ich weg, wollte nicht als Gaffer dastehen. Und linste doch nach kurzer Zeit wieder rüber, gierig auf den Anblick der nackten Mädchenrücken und Brüste, die mit etwas Glück an der Seite auftauchten, vor allem natürlich bei Kristina und Silke.
Kaum waren wir mit Aufbauen und Umziehen fertig, stürzte Bernd sich wie ein Berserker ins Wasser. Üblicherweise kam er nach kurzer Zeit zurück, in der Hand eine wabbelige Qualle oder ein Büschel tropfendes Seegras. Die Mädchen ahnten bereits, was er vorhatte, und stoben kreischend auseinander. Bernd pickte sich eine heraus, und wenig später sah man ihn und sein Opfer im Zickzack durch den Sand rennen. Er war am ganzen Körper dicht behaart und bereits nach wenigen Tagen dunkelbraun gebrannt.
Nach dem Sprung ins kühle Nass wechselte er grundsätzlich die Badehose: ratsch, die nasse aus und eine trockene wieder an. Niemand machte deswegen blöde Witze oder lachte. Ich hatte am Anfang meine Hose nach dem Baden trotzdem lieber anbehalten und am Körper trocknen lassen – wie ich es halt aus der Nordstadt kannte, von unseren raren Freibad-Besuchen dort. Aber mittlerweile machte ich es wie Bernd, denn es gab definitiv Angenehmeres als so einen klatschnassen Lappen auf der Haut. Komisch, dass ich die Schönhagener in der ersten Zeit immer als so bieder wahrgenommen hatte. Eigentlich war hier alles viel unverkrampfter und weniger prüde als in der Nordstadt.
Wobei ich es selbst nie besonders eilig hatte mit dem Baden. Lieber beobachtete ich erst ein bisschen das Schauspiel zwischen Bernd und den Mädchen oder ließ meinen Blick einfach durch die Gegend schweifen. Aber irgendwann raffte ich mich doch auf. Das Wasser auf der Haut zu spüren tat jedes Mal wieder gut. Ein kurzes Eintauchen in die Wellen, und die Benommenheit durch die Hitze hatte sich verflüchtigt. Dann schwamm ich am liebsten zur Quermole, kletterte auf den Steinwall und setzte mich in die Sonne. Auf der Seeseite klatschten die Wellen mit Wucht gegen die Felsen, Gischt sprühte hoch und regnete erfrischend auf mich herab.
Wenn mir langweilig wurde, warf ich mich auf der geschützten Seite wieder in die Fluten. Bis zum Ende der Mole waren es bloß ein paar Züge. Ab hier rollten die Wellen wieder ungehindert heran und trieben mich rasch auf den Strand zu. Vorher kam aber noch die erste Sandbank, wo man Grund hatte und ein bisschen durchs Wasser waten konnte. Wie kristallklar es war und wie weich der Boden – nicht ein einziger Stein war zu spüren, auch keine Muscheln, überall nur Sand. Wenn eine besonders hohe Welle kam, ließ ich mich hineingleiten und ein Stück mittragen.
Meistens verging über eine Stunde, bevor ich mich wieder vom Wasser trennte. „Du darfst nicht so lange drin bleiben“, ermahnte Kristina mich regelmäßig, wenn sie meine vor Nässe verschrumpelten Fingerkuppen sah, „das ist nicht gesund.“ Aber ich hatte nur wenig Lust, mir darüber Gedanken zu machen. Noch spürte ich keine Schäden.
Danach konnte ich Ewigkeiten in der Sonne liegen, ohne dass mir zu heiß wurde. Ein Teil von mir schlief, ein anderer nahm die Geräusche der Umgebung umso deutlicher wahr: Geschirrklappern, das Zischen einer Brauseflasche, das Klacken eines Balls auf Holzschlägern. Die Laute wirkten inmitten des Wellenrauschens wie abgeschnitten von ihrer Quelle; man wusste nie, ob sie von nah oder fern kamen. Wenn ich die Augen wieder öffnete und der Blick langsam klar wurde, konnte man sehen, dass direkt neben mir Silke eine Limo geöffnet hatte, Bernd und Kristina an der Wasserlinie Strandball spielten, Jürgen sich gerade Kartoffelsalat auf einen Teller füllte.
Einmal beobachtete ich heimlich Maren, wie sie neben mir saß und sich eincremte. Sie war gerade aus dem Wasser gekommen und hatte sich umgezogen, trug jetzt ihren schwarzen Badeanzug. An einigen Stellen sah man noch winzige Tropfen auf ihrer Haut glitzern. Mit langsamen, fast andächtigen Bewegungen verteilte sie die Sonnenmilch auf Armen und Beinen. Dann kam das Beste: Sie öffnete ihre Haarspange, und die goldenen Massen rauschten herab, ergossen sich über Schultern und Nacken. Auf ihrem Badetuch liegend breitete Maren das Haar um sich zum Trocknen aus. Vor dem dunklen Stoff wirkte es wie ein Strahlenkranz, der ihr schönes Gesicht einrahmte.
Ich fand es immer noch schade, dass ihre Brüste so klein waren. Manchmal glaubte ich die abfälligen Kommentare der alten Kumpels aus der Nordstadt zu hören: „Flach wie ein Brett“, „Nix unterm Hemd“ und so weiter, die üblichen Sprüche halt. Aber Maren brauchte nur irgendeine kleine Bewegung zu machen, das Bein anzuwinkeln, sich eine Strähne aus dem Gesicht zu wischen, die Sonnenbrille in die Stirn zu schieben – und alle Bedenken waren verschwunden. Sie war für mich der schönste Mensch auf der Welt.
Von Heiner wusste ich, dass Bernd früher unsterblich in sie verliebt gewesen war. Aber sie hatte immer bloß Augen für Rusi gehabt. Obwohl Bernd dann mit Kristina zusammengekommen war, glaubten einige, dass er insgeheim seine Hoffnungen bis heute nicht aufgegeben hatte. Ich fragte mich, wie Maren das wohl sah? Wusste sie überhaupt davon? Irgendwann würde ich sie darauf ansprechen.
Jürgen ging fast nie ins Wasser. Er bewegte sich überhaupt äußerst ungern, lag die ganze Zeit bloß träge auf seinem Handtuch in der prallen Sonne. Allerdings cremte er sich ungefähr 20 Mal am Tag ein, weil er panische Angst vor Sonnenbrand hatte. Mit dem Ergebnis, dass er noch genauso schwabbelig-weiß war wie zu Beginn des Sommers.
Spätnachmittags wandte ich mich notgedrungen dem Schulkrams zu. Mutterns Kontrollen waren mittlerweile etwas laxer geworden, sonst hätte sie garantiert gemerkt, dass jetzt immer Sand aus den Heften rieselte, und mich ermahnt, dass der Strand nicht geeignete Ort war, um Hausaufgaben zu machen. Das stimmte sicher, aber nun, da es in der Schule so gut stand, konnte man es ruhig etwas lockerer angehen, fand ich.
Wenn von der Landseite allmählich Schatten herangekrochen kam, wurde es Zeit, aufzubrechen. Wir spülten unsere Badesachen im Wasser aus, packten zusammen und schlenderten gemütlich durch die Dünen zurück. Am Deichfuß mussten wir in die Schuhe steigen – barfuß hätte man sich auf dem erhitzten Asphaltstreifen glatt die Sohlen verbrutzelt. Oben ein letzter Blick übers Wasser, dann verschwand die See hinter dem Deich. Das jähe Aussetzen des Wellenrauschens war immer aufs Neue verwirrend – plötzlich wurde es vollkommen still, als hätte jemand den Ton abgedreht.
Und wieder die Radfahrt durch die Felder. Die ersten wurden bereits abgeerntet, über den Stoppeln stand der Kornstaub. Nach wie vor war es brütend heiß, unablässig zirpten die Grillen. In Steenbarg liefen überall Kinder durch die Straßen. Die Fenster und Türen der alten Bauernhäuser waren geöffnet, man sah Leute in ihren Gärten beim Essen sitzen.
Schließlich kamen wir wieder nach Schönhagen. Häuser und Asphalt glühten von der Hitze des Tages, die Luft roch nach Sommer und Ferien.
***
Oft trafen wir uns nach dem Abendbrot noch auf der Wiese in unserer Straße, alle frisch geduscht und geföhnt. Maren und ich saßen Rücken an Rücken gelehnt auf unserer Wolldecke. Sie trug immer einen ihrer kurzen, buntgemusterten Sommerröcke, die ihre kindlichen, etwas zu stämmigen Oberschenkel so süß aussehen ließen. Mittlerweile hatte ich ihre Beine schon oft berührt, und tatsächlich war die Haut dort ebenso weich wie an den Armen.
Oder wir gingen runter ins Dorf. Holten uns Eis, setzten uns auf die Grüne Insel, quatschten mit den Leuten, die wir dort trafen. Über die Schule und die bevorstehenden Zeugnisse, das Sommerfest, unsere Pläne für die Ferien. Hier gesellte sich meistens auch Heiner zu uns. Er hatte im Jahr zuvor eine Lehre angefangen und musste tagsüber schuften. Der Gedanke klang für mich nach purem Horror: den kompletten Tag in einer Tretmühle von Firma feststecken, derweil wir uns am Strand die Sonne auf den Bauch scheinen ließen. Ja, er sei ein Sklave, seufzte Heiner, wenn man ihn darauf ansprach, und stieß laut die Luft durch die Nase aus. Bei diesem Geräusch wusste man nie, ob er lachte oder seinen Frust ausdrückte: Die Lehre nervte ihn ziemlich, er ließ keine Gelegenheit aus, um lautstark zu schimpfen. Ich war wirklich froh, nicht in seiner Haut zu stecken.
Wenn ich mit den anderen dort saß und an mir herabblickte, staunte ich jedes Mal, wie braun ich geworden war. Nach unserem ersten Strandausflug hatte ich mir einen derben Sonnenbrand geholt. Reste abgepellter Haut an den Unterschenkeln und Fußknöcheln zeugten noch davon. Aber diese Zeiten waren lange passé. Mittlerweile brauchte ich nicht mal mehr Sonnencreme.
Nur eine Sache war seltsam: Seit neuestem interessierten sich die Mücken lebhaft für mich. Früher hatten sie mich immer links liegen gelassen, aber jetzt war ich völlig zerstochen. Egal ob an Fußknöcheln, Armen, Beinen oder am Hals – überall hatte ich rote, juckende Schwellungen, eine neben der anderen, wie an einer Schnur aufgezogen.




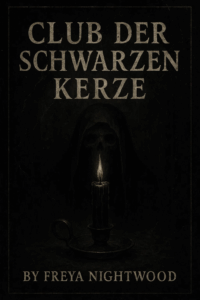



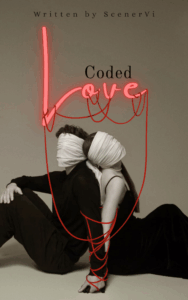





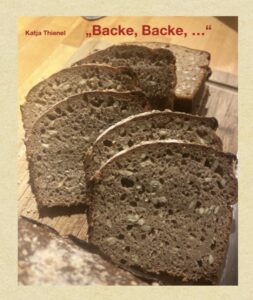








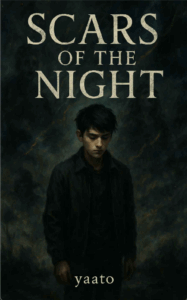










Kommentare