38. Fahrt in die Finsternis


Das Fahrrad gewann ein dickbäuchiger Glatzkopf in Bermudashorts und Unterhemd aus Feinripp. Der Typ glänzte im Scheinwerferlicht wie frisch geölt, so sehr lief ihm der Schweiß runter. Da ging er hin, unser toller Hauptpreis. Ich bezweifelte, dass der Kerl das Rad jemals benutzen würde. Selbst bei Henri wäre die Schleuder in besseren Händen gewesen. Hätte ich ihm doch nur sein verdammtes Los geschenkt!
Als die Lichter ausgingen und die anderen mit dem Abbauen loslegten, zog Bernd mich zur Seite: „Ich fahr schon mal vor, den Kamin anheizen.“
Wozu wollte er bei dieser Hitze Feuer machen?
„Soll noch Gewitter geben. Wird sich abkühlen, glaub’s mir.“
Und so radelte ich allein nach Schönhagen zurück. Mittlerweile war es vollständig Nacht geworden. Die Finsternis erschien mir tiefer als sonst, undurchdringlicher. Als ich kurz Halt machte, um mir eine zu drehen, konnte ich kaum die Hand vor Augen erkennen. Eine angespannte, beklemmende Stimmung lag in der Luft, auch das Grillenzirpen wirkte heute auffallend laut und hektisch – fast wie eine Warnung…
Was mochte uns nachher im Geisterhaus wohl erwarten? Wirklich nur ein bisschen Gruseln und Gänsehaut, sonst nichts? Das konnte mir kaum vorstellen, nach dem Erlebnis auf der Kellertreppe. Dieser eisige Luftstrom, das bedrohliche Pfeifen und Zischen, auch der Sog in die Tiefe – alles war so deutlich gewesen! Dazu kam die Story mit den Toten, das Gerede über Schwarzen Messen – sollte man ernsthaft mitten in der Nacht einen Ort betreten, an dem so furchtbare Sachen passiert waren? Überschritten wir damit nicht eine rote Linie? Rührten wir nicht an Dinge, die in Ruhe gelassen werden wollten?
Zu Hause angekommen ging ich direkt in den Keller und schaufelte ein paar Dosen Bier in den Rucksack. Leider waren sie lauwarm – kein Wunder bei den tropischen Temperaturen der letzten Zeit. Dann holte ich von oben den Schlafsack und fuhr mit dem kompletten Gepäck zum Treffpunkt am Achterkamp. Die Mädchen ließen gerade eine Rotweinflasche kreisen und gackerten unaufhörlich. Ihr Flohmarkt war wohl ein Bombenerfolg gewesen. „Wieder viel Platz im Keller“, meinte Kristina. Jürgen wirkte ebenfalls schon recht angeheitert. „Ein kleiner Umtrunk auf der Feuerwache, nach dem Abbauen am Steenbarger Bahnhof“, erklärte er. Anstatt sorgfältig vorbereitetem Proviant, wie neulich, nahmen wir heute nur Wein, Bier und harten Alk wie Rum oder Wodka mit. Alles war hastig aus den heimischen Kühlschränken, Wohnzimmerbars und Kellern zusammengeklaubt.
Die anderen hatten auch Badesachen dabei: Sie wollten erst mal zum Strand, sich eine Abkühlung verschaffen, und erst danach zur Party. Ich protestierte, fand es ziemlich mies, Bernd so lange im Geisterhaus allein zu lassen. Außerdem hatte ich kein Handtuch eingepackt und – vor allem – keine Badebüx. „Trockne dich halt mit der Unterhose ab“, meinte Kristina und prustete los. „Kannst sonst mein Handtuch mitbenutzen“, bot Heiner an, der schon reichlich stoned wirkte. Na, Herzlichen Dank! Notgedrungen fuhr ich nach Hause zurück, um die fehlenden Sachen zu holen.
Dann ging es erst mal nach Steenbarg, anstatt zum Geisterhaus. In den Feldern hatte die drückende Hitze kaum abgenommen, obwohl es schon so spät war. Immer wieder fegten Windböen heran und schüttelten alles durch. Hinterher setzte das nervtötende, monotone Fiepen der Grillen von Neuem ein, als wäre nichts gewesen.
Am Abzweig nach Hoheneck drosselte ich das Tempo. Mir war, als hätte ich dort auf dem Weg etwas gesehen, ganz hinten, eine Bewegung oder einen Schatten – nein, die beiden Wegspuren waren leer. Und doch kam etwas von dort aus dem Dunkel… ein seltsames Vibrieren, wie ein Kraftfeld. Einmal spürte ich es besonders deutlich, es strahlte Wärme aus, dazu eine Art Magnetismus. Auch einen leisen Ton nahm ich jetzt wahr, schwingend, beinahe ein Heulen. Meine Güte, was konnte das sein? Ich bekam Panik, trat in die Pedale – bloß weg hier!
Fast hatte ich die anderen wieder eingeholt, da gab es plötzlich einen Ruck, und meine Kette lief ab. Verflucht, das passierte mir ständig in letzter Zeit! Ich stoppte per Handbremse, stieg vom Rad und beleuchtete mit dem Feuerzeug die Bescherung.
„Was gibt’s?“ Heiner hatte das Quietschen der Bremse gehört und war zurückgekommen. „Soll ich helfen?“
„Fahrt ihr mal weiter, ich komm dann nach“, brummte ich. Die anderen sollten nicht schon wieder auf mich warten müssen, wie vorhin, als ich noch die Badesachen geholt hatte.
Aber kaum waren sie verschwunden, bereute ich meine Entscheidung wieder. Allein wirkte hier draußen alles noch finsterer und schwärzer. Die Angst kroch jetzt mit voller Wucht in mir hoch, ein lähmendes Gift, das sich rasend schnell ausbreitete. Meine Arme fühlten sich auf einmal wie Pudding an, ich schaffte es kaum, das Fahrrad umzudrehen. Hektisch versuchte ich die Kette auf die Zahnräder zu bekommen, aber je ungeduldiger ich wurde, desto weniger wollte es klappen. Verdammte Dunkelheit! Aber ich ahnte, dass es nicht bloß daran lag…
Irgendetwas ging hier draußen vor sich. Diese Nacht war anders als sonst. Schwärzer, geheimnisvoller. Das gruselige Vibrieren eben am Abzweig – es war ganz sicher keine Einbildung gewesen. Und seltsam: Obwohl es ja aus Richtung Hoheneck gekommen war, sagte mir ein siebter Sinn, dass die Quelle im Geisterhaus lag. Für mich war das völlig klar, es konnte gar nicht anders sein. Etwas Unheimliches strahlte von dort auf die Umgebung aus, das sich mit bloßer Vernunft und Physik nicht erklären ließ. Es hing irgendwie mit den beiden Selbstmördern zusammen, die man in dem Haus gefunden hatte, mit ihrer obskuren Sekte und den Schwarzen Messen. Und auch mit den Geräuschen aus den Katakomben. Aber nicht nur das: Eine Art roter Faden zog sich von diesen Dingen bis zu mir, meinem Leben, meiner Vergangenheit. Alles schien miteinander verwoben. Und in Nächten wie dieser, so kam es mir vor, verließen die Geister ihr Haus, um auszuschwärmen, durchs Dunkel zu streifen…
Ein rätselhafter Lichtschein tauchte nun aus Richtung Steenbarg auf. Er schwebte übers pechschwarze Feld, erreichte den Weg, tastete sich am Knick entlang, forschend, prüfend, ein Irrlicht auf der Suche. Dann fand es seine Richtung, glitt auf mich zu, langsam erst, aber immer schneller…
Endlich hörte man das Schnarren eines altersschwachen Dynamos. Kurz darauf kam Heiner angeradelt: „Wollte lieber mal gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist.“ Die Erleichterung, die ich in diesem Moment spürte, ließ sich kaum beschreiben: eine Fahrradlampe, na klar, logisch! Was hätte es wohl sonst sein sollen?
Er leuchtete mir mit seinem Feuerzeug, und ich bekam die Kette schnell wieder auf die Zahnräder. Anschließend waren meine Finger natürlich eingesaut, aber Heiner fand in seiner Tasche eine Packung Tempos – ohne ihn wäre ich gerade ziemlich aufgeschmissen gewesen! Gemeinsam fuhren wir weiter. Meinen Plan, nach Schönhagen umzukehren, verwarf ich kurzerhand – ich wollte jetzt nicht allein sein.
In Steenbarg hatten sich die Straßenlaternen längst abgeschaltet, auch die Fenster waren allesamt dunkel. Der Ort wirkte, als stünde ein Luftangriff bevor. Wieder in den Feldern frischte der Wind stark auf, das Treten wurde zu einer mühseligen Angelegenheit. Die Lichtkegel unserer Fahrradlampen ließen das Buschwerk gespenstisch hervortreten, es wirkte, als wären wir in einem Tunnel, einem beklemmend engen Schlauch ohne Ausgang.
Endlich sahen wir vor uns abgestellte Räder, auch den Graswall des Deichs – wir waren da. Leider währte die Erleuchtung bloß kurz: Beim Bremsen erloschen die Fahrradlichter, mit einem Schlag wurde es pechschwarz – als hätte jemand ein gigantisches Tintenfass über uns ausgestülpt. Eine Taschenlampe wäre jetzt Gold wert gewesen, aber an die hatten wir natürlich nicht gedacht.
Quasi blind tasteten wir uns mitsamt dem Gepäck bergan. Schon von hier hörte man, wie schwere Brecher auf den Strand schlugen. Landeinwärts wurden die Bäume mittlerweile von Böen regelrecht gepeitscht. Oben auf dem Deich packte uns der Sturmwind so richtig. Wir stolperten runter zum Deichfuß, irrten durch den Dünengürtel, erreichten irgendwie den Strand, wo uns der Wind pausenlos Sandfontänen entgegentrieb. Allmählich schälten sich weiße Wellenkämme aus dem Dunkel. Und von Zeit zu Zeit konnte man inmitten des Brandungslärms leises Jauchzen und Lachen hören – sie waren also tatsächlich dort rausgeschwommen.
„Auf ins Getümmel.“ Heiner begann sich die Klamotten abzustreifen. „Wir kommen!“, brüllte er in die tosende See hinaus.
„Na, dann mal los!“, antwortete Kristina nach einer Weile.
Widerwillig ließ ich ebenfalls die Hüllen fallen. Die Badehose blieb im Rucksack – ich wollte auf nun doch nicht der einzige Bekleidete unter lauter Nackedeis sein. Sicherheitshalber machte ich unsere Plünnen mit ein paar herumliegenden Steinen windfest, dann folgte ich Heiner. Die ersten Wellenausläufer umspülten meine Fußknöchel – das Wasser war kaum kühler als die Luft. Mit dem Mut der Verzweiflung warf ich mich in die Brandung und paddelte, was das Zeug hielt.
„Hey, schwimmt zum Boot!“, rief Silke uns zu. Wir folgten ihrer Stimme, es ging bergauf und bergab durch die Wellen, bis schließlich vor uns etwas Weißes auftauchte. „Seid ihr da?“, schrie Heiner.
„In voller Truppenstärke!“, bellte Jürgen und lachte.
Der weiße Umriss entpuppte sich als Segeljolle mit abgenommenem Mast, die in der Brandung stark krängte. Heiner zog sich flink an der Bordwand hoch und kletterte hinein, als würde er das täglich machen. Ich schaffte es nicht, rutschte immer wieder ab. Endlich fand ich irgendwie Halt und hievte ich mich mit letzter Not in den Kahn. Es musste absolut bescheuert ausgesehen haben – zum ersten Mal an diesem Abend war ich ernsthaft froh über die Finsternis.
Patschnass setzte ich mich auf die Reling. Die verdammte Nussschale schaukelte dermaßen, dass ich ernsthaft befürchtete, den Halt zu verlieren und wieder ins Wasser zu plumpsen. Die Mädchen hockten anscheinend alle auf der Bootsbank in der Mitte. Fieberhaft versuchte ich mir den Anblick auszumalen: drei sehr hübsche Mädchen, alle splitternackt – aber es gelang mir nicht. Ich konnte auf einmal an nichts Schönes mehr denken, nichts Gutes mehr empfinden, alles schien nur noch hässlich, finster, furchterregend. Die Atmosphäre war jetzt endgültig bis zum Zerreißen gespannt.
Etwas Kaltes, Feuchtes berührte mich am Arm. Ich zuckte zusammen, dachte im ersten Moment an eine Qualle. Dann merkte ich, dass es Marens Hand war. Instinktiv rückte ich ein Stückchen weg, um außer Reichweite zu gelangen. Ich schämte mich plötzlich über alle Maßen, nackt zu sein. Und trotz der warmen Luft schlotterte ich, fühlte mich wie krank. Konnte es am Heuschnupfen liegen? „Mir wird kalt“, murmelte ich und sprang wieder ins Wasser.
Im Nu hatten mich die Wellen an den Strand zurückgetrieben, nicht weit von der Stelle entfernt, an der unsere Klamotten lagen. Der Wind hatte tatsächlich versucht, sie wegzuzerren, aber dank der Steine ohne Erfolg. Während des Anziehens registrierte ich plötzlich, dass die Mitternachtssonne gar nicht zu sehen war. Auch der Mond schien nirgends, und kein einziger Stern stand am Himmel. Endlich begriff ich: Es musste sich bewölkt haben, irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit. Stimmte es, was Bernd gesagt hatte? Zog tatsächlich ein Unwetter auf?
Ich hörte die anderen aus dem Wasser zurückkehren, noch immer feixend und herumalbernd. Aber sie schienen auf einmal Lichtjahre entfernt, ihr Lachen erreichte mich nicht mehr. Als wir losgingen, schaffte ich es kaum, ihnen zu folgen. Ich gab alles, holte das Letzte aus mir heraus, auch kam der Wind jetzt von hinten – aber etwas anderes war trotzdem stärker, eine geheimnisvolle Kraft, die mich zu sich in die Tiefe ziehen wollte…
Bald waren sie weit voraus, man konnte ihre Stimmen inmitten des Wellenrauschens kaum noch erkennen. Als ich endlich oben auf der Deichkrone ankam, zog landeinwärts ein Lichterpulk gerade davon wie Glühwürmchen auf der Flucht. Der Anblick versetzte mir einen Stich – merkten sie nicht, dass jemand fehlte? Panisch rannte ich runter zum Rad, das als einziges noch dort stand, lud das Gepäck auf und strampelte um mein Leben. Als ich kurz zurückschaute, hatte die Nacht den Deich längst wieder verschluckt.
Auf einmal drifteten alle Lichter abrupt nach rechts. Seit wann zweigte dort ein Weg ab? Das konnte doch gar nicht sein! Aber an der fraglichen Stelle fand ich einen Feldweg wie alle anderen vor, mit betonierten Spuren und einem Grasstreifen in der Mitte. Es wirkte fast wie Hohn: Tausendmal waren wir auf unseren Strandtouren hier vorbeigefahren, und nie hatte den Abzweig bemerkt. Kannte ich überhaupt irgendwas in dieser Gegend? War ich nicht immer noch ein Fremder, ein Zugezogener?





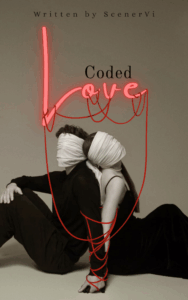






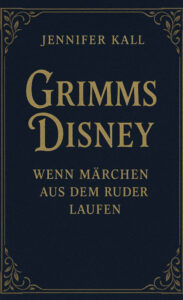




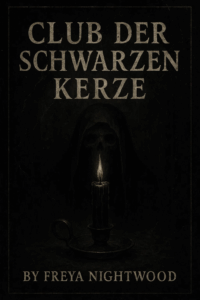























Kommentare