06. Klausurenstress


Langsam neigte das erste Semester sich dem Ende zu, die Klausuren standen an. Eigentlich kein Grund für mich, in Panik zu verfallen. Bisher war alles perfekt gelaufen, ich galt als einer der Jahrgangsbesten. Doch auf einmal ging mir die Muffe.
Für die anderen mochte es wirken, als schüttele ich die hervorragenden Leistungen einfach aus dem Ärmel. Ich bemühte mich selbst nach Kräften, diesen Eindruck zu erzeugen und zu nähren. In Wirklichkeit plagte und quälte ich mich schier bis zum Umfallen. Ich war nie ein guter Schüler gewesen und war es nach wie vor nicht. Jede gute Note musste ich mir hart erkämpfen.
Jetzt nahte die Stunde der Wahrheit. In den Klausuren, wo ich keine Hilfsmittel zur Verfügung hatte, wo zudem die Zeit knapp bemessen war, musste ich beweisen, ob ich es wirklich drauf hatte. Gut möglich, dass mein Ruf demnächst ruiniert war und ich einpacken konnte.
Ein weiterer Aspekt kam hinzu, und gerade diesen mochte ich mir kaum eingestehen: Ich wollte die Profs, die auf mich und meine vermeintlichen Fähigkeiten ach so große Stücke hielten, nicht enttäuschen. Besonders Professor Spengler nicht, der die Grundlagenvorlesung in Mathematik hielt und einer meiner eifrigsten Förderer war. Musste ich nicht damit rechnen, dass er mir die Zuwendung entzog, wenn ich in seinem Fach versagte? Und hätte er nicht recht gehabt? Täuschte ich ihn und den Rest der Welt nicht bloß? Wann legte ich endlich meine Maske ab und ließ die anderen sehen, wie mittelmäßig ich in Wirklichkeit war?
Ich büffelte wie ein Bekloppter. Jedenfalls versuchte ich das. Leider eignen sich gerade Fächer wie Mathematik oder Informatik nur schlecht fürs Pauken. Es gilt, Lösungsalgorithmen für Problemstellungen zu entwickeln, Zusammenhänge herzuleiten, Sätze zu beweisen. Auswendig zu lernen gab es hier so gut wie nichts. Also kramte ich alte Übungsaufgaben wieder hervor, suchte mir neue in Büchern, die ich mir aus der Hochschulbibliothek lieh. Immer wieder probierte ich die verschiedenen Beweisverfahren durch, zeichnete UML-Diagramme für diverse EDV-Probleme, setzte in Beispielanwendungen die gängigen Entwurfsmuster um. Ich versuchte mich auf jede Eventualität vorzubereiten und konnte dennoch die Panik nicht abschütteln.
Dann lag die erste Klausur hinter uns. Es war die von Professor Spengler gewesen, und natürlich hatte mich keine der Aufgaben vor größere Probleme gestellt. Am Abend – es war ein Freitag -wollten einige von uns eine „Erste-Klausur-Überstanden“-Party im Grünen Hund feiern.
Anfangs hatte mich die aufgeladene, hektische Atmosphäre des Ladens sehr fasziniert. Alle wollten etwas erleben, rauslassen, wollten breit sein, verrückt sein. Man trank viel, quatschte, tanzte, hing auf den Sofas ab, die überall herumstanden, qualmte und kiffte.
Aber mir war schnell klar geworden, dass ich im Grünen Hund fehl am Platz war. Zum Tanzen hatte ich keine Lust, zum Reden fand ich es zu laut. Es blieb mir ein Rätsel, wie die anderen sich in diesem Krach verständigen konnten Ich klinkte mich immer schnell aus der Unterhaltung aus. Stand nur noch untätig herum, trank Bier, glotzte. Die Stunden verstrichen, der Alkohol tat seine Wirkung, erst angenehm, später lähmend. Es war, als würde mich dieser Ort gefangenhalten. Ich war seiner Düsternis, dem Stress, den menschlichen Ausdünstungen hilflos ausgeliefert. Nur der Abmarsch meiner Truppe, der häufig erst im Morgengrauen erfolgte, konnte den Bann brechen und mich aus meiner Paralyse befreien.
An diesem Freitagabend nach der überstandenen Mathe-Klausur war es besonders schlimm. In der zurückliegenden Nacht hatte ich schlecht geschlafen, war aus Angst vor der Prüfung immer wieder hochgeschreckt. Jetzt, da alles vorbei war und die Spannung von mir abfiel, fühlte ich mich wie gerädert. Ich hätte also besser zu Hause bleiben und den versäumten Schlaf nachholen sollen. Aber in letzter Zeit hatte ich mich schon zu oft ausgeklinkt, deshalb mochte ich nicht kneifen. Außerdem war an den Wochenenden oft Remmidemmi im Wohnheim und an Schlaf eh nicht zu denken. Ich fuhr also mit Rico, Christoph und René in den Grünen Hund.
Obwohl es regnete, hatten wir das Rad genommen, wahrscheinlich aus purer Gewohnheit. Bereits nach kurzer Strecke spürte ich, wie die Nässe durch meine Klamotten drang. Im Grünen Hund war es wie immer: voll und laut. Ich verlor die anderen schnell aus den Augen. Bereits nach zwei Bieren war mir stark schwindelig. Ich verzog mich in den schmalen Durchgang zwischen der Tanzfläche und der Scheunenrückwand, wo sich immer die Fertigen sammelten. Krampfhaft lehnte ich mich gegen die Wand, in der ernsthaften Befürchtung, jeden Moment umzukippen. Jedes Zucken des Stroboskop-Lichtes auf der brechend vollen Tanzfläche traf mich wie ein Blitz.
Zum Glück ging es mir bald wieder besser. Ich fasste den Entschluss, die anderen zu suchen. Am Tresen begegnete ich Katja, zusammen mit Ferdinand und Doreen, zwei ihrer Kommilitonen. Freudiges Hallo. Sie waren mit Ferdinands altem Trabbi hier, wegen des Regens. Bald tauchten auch Christoph, Rico und René wieder auf. Doreen schlug vor, bei ihr weiterzufeiern. Eigentlich wollte ich am liebsten in mein Bett, aber irgendwas versperrte mir den Mund. Stattdessen folgte ich den anderen zum Ausgang.
Draußen großes Durchatmen. Der Regen hat aufgehört, über dem Dach des Grünen Hundes leuchtet der Vollmond. Christoph und Rico sind augenscheinlich nicht mehr fahrtauglich, und Ferdinand bietet an, sie in seinem Trabbi mitzunehmen. Allerdings müsse eine der Frauen dann bei uns auf dem Gepäckträger mitfahren. Katja meldet sich freiwillig.
Mir schwant Unheil. Inständig hoffe ich, dass René sich ihrer erbarmt. Aber natürlich geschieht, was ich befürchtet habe: Sie will zu mir. Ein Ruck, und schon hat sie sich auf den Gepäckträger gesetzt. Na denn. Ich steige auf, will losfahren – und verliere auch schon das Gleichgewicht, kann nur im letzten Moment einen Sturz verhindern. Neuer Versuch – wieder vergeblich. Diese Lähmung ist plötzlich zurück, diese innere Kraftlosigkeit, wie beim Sport. Möglicherweise liegt es auch schlicht am Alkohol. Gerade will ich ein drittes Mal ansetzen, als ich spüre, wie Katja absteigt. „Lass mich mal“ sagt sie, schiebt mich kurzerhand vom Sattel und setzt sich.
„Worauf wartest du noch?“ Sie zeigt auf den Gepäckträger. Betreten lasse ich mich nieder, dann geht auch schon die Post ab. Schnell haben wir René eingeholt, der gemütlich dahinradelt, freihändig, sich eine Zigarette drehend. Seine verdutzte Miene, als Katja und ich mit vertauschten Rollen an ihm vorbeiziehen, das Grinsen, das sich anschließend auf seinem Gesicht breit macht – die Bilder brennen sich unauslöschlich in mein Gedächtnis ein. Dann überholen wir Ferdinands Trabbi, der vor einer roten Ampel wartet. Und natürlich überholt er uns bald wieder. Die Lichthupe blinkt, aus dem Wageninnern ertönt lautes Gejohle. Es ist ein regelrechter Albtraum.
Wir kommen in die Oststraße, wo Doreen in einem der prachtvoll renovierten Gründerzeitbauten wohnt. Der Trabbi parkt bereits vor der Haustür. Katja sagt nichts, sie scheint die Sache ganz locker zu sehen. Im Grunde hat sie ja recht; ich weiß selbst nicht, wieso ich mich in diesem Moment so blamiert fühle. Als würde ich es nicht bringen, als sei ich ein kompletter Versager.
Drinnen ist die Party bereits in vollem Gange. Die Wohnung ist riesig und mit den edelsten Designermöbeln eingerichtet. Doreen macht ihr BWL-Studium nur nebenbei, arbeitet in der Hauptsache als Event-Managerin im neu eröffneten Aqua-Wunderland und scheint damit richtig Kohle zu verdienen. Nichts an ihr verrät, dass sie aus dem Osten kommt. Mit ihren modischen Klamotten, dem stylishen Haarschnitt und der sonnengebräunten Haut ist sie für mich der West-Yuppie schlechthin.
Jetzt kramt sie einen Likör hervor, den sie aus ihrem Brasilien-Urlaub im letzten Jahr mitgebracht hat. Er heißt „103″ und ist dort drüben wohl ein ziemlicher Schlager. Alle müssen mindestens ein Glas trinken. Schon als mir das Zeug die Kehle hinabrinnt, merke ich, wie es einschlägt. In meinem Kopf startet jetzt endgültig die Berg- und Talbahn, bald dämmere ich nur noch vor mich hin. Katja scheint auch heute immer in meiner Nähe zu sein. Aber selbst wenn ich gewollt hätte: Zu einer Reaktion, einem Auf-Sie-Zugehen wäre ich definitiv nicht mehr in der Lage gewesen. Ich wäre sozusagen wieder vom Rad gekippt.
Dann nicke ich ein. Es kommt mir wie ein Sekundenschlaf vor, aber als ich die Augen wieder öffne, sitzen dort nur noch Doreen und Ferdinand. Rückt er ihr auf die Pelle? Eigentlich kann das nicht sein, denn er ist in einer festen Beziehung, spricht ständig von Heiraten und Kinderkriegen. Nein, ich muss mich täuschen.
Irgendwann raunzt Ferdinand mich an: „Sag mal, Sven, willst du nicht endlich mal gehen?“ Sein genervtes Gesicht spricht Bände. Ich bin schlagartig nüchtern, jedenfalls für einige Sekunden. Hastig murmle ich ein „Sorry!“ und sehe zu, dass ich wegkomme.
Draußen hat es mittlerweile wieder zu schütten angefangen. Ich steige aufs Rad und lasse mich von der Oststraße bergab rollen, direkt in die Innenstadt. Am Markt stoppe ich und spähe zum Kirchberg hinauf, versuche den Zeigerstand auf der großen Uhr der Schlosskirche zu entziffern. Normalerweise ist das von hier aus kein Problem, aber jetzt gelingt es mir nicht mehr. Mein Zustand ist mindestens grenzwertig. Dass es mir dennoch gelingt, einigermaßen sicher wieder aufs Rad zu kommen und sogar eine gerade Linie zu fahren, erfüllt mich regelrecht mit Stolz.
Plötzlich glaube ich hinter mir ein Polizeiauto hinter mir zu sehen. In meinem Zustand nehmen die mir glatt den Führerschein ab! Geistesgegenwärtig biege ich in die Quergasse, die für Autos zu schmal ist. Ich beglückwünsche mich innerlich noch zu meiner Raffinesse, als ich plötzlich gegen den Kantstein krache. Ein Satz, und ich liege auf dem regennassen Pflaster. Schmerzen spüre ich keine, vermutlich dank des Alkohols. Da sehe ich die Bescherung: Das Vorderrad ist regelrecht verknüllt.
Ich habe das Rad geschultert, trage es im strömenden Regen die dunkle Straße entlang. Zum Wohnheim ist es noch ein gutes Stück. Niemand ist zu sehen, aber immer wieder meine ich von irgendwoher Gelächter zu hören, schallendes Gelächter. „Streber“, scheinen die Stimmen zu rufen, „hau endlich ab“.







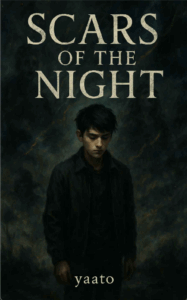


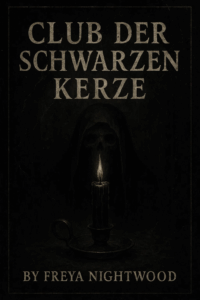















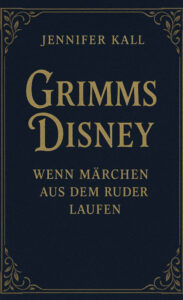














Kommentare