18. Der Weg zurück


Der Wald lag längst hinter mir, bis zum Horizont sah man nur noch Felder und Knicks. In den Senken tauchten manchmal Teiche auf, die das umliegende Grün widerspiegelten. Und zur Rechten zeigte sich immer wieder die See zwischen den Hügeln. Über mir schwirrte eine Handvoll Spatzen unermüdlich herum, am Wegrand hockten zahlreiche Kaninchen. Sobald ich mich näherte, hoppelten sie davon und formierten sich ein Stück weiter vorn neu. Ansonsten war ich allein. Die Natur schien endlos, und doch wies mir der Weg die Richtung, gab mir Halt inmitten der Weite.
Mechanisch setzte ich einen Fuß vor den anderen. Stieg die Hügel hoch und ließ mich, wenn es wieder bergab ging, nach vorn fallen, sodass die Füße automatisch nachzogen, um den Sturz zu verhindern. Es war, als würde ich auf unsichtbaren Schienen gleiten anstatt zu laufen. Längst hatte ich auch jegliches Zeitgefühl verloren. Wie lange mochte ich inzwischen hier draußen unterwegs sein? Zwei Stunden? Vier? Aber anhalten und auf die Uhr schauen wollte ich nicht, das hätte mich aus dem Tritt gebracht. Es war hell, das genügte mir. Und noch immer hatte ich diese innere Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein.
Nach einer schieren Ewigkeit erreichte ich eine Gruppe alter, windschiefer Häuser an einer verlassenen Straße. Die Gebäude waren kaum höher als ich, so flach duckten sie sich ins Land. Nirgends waren Menschen zu sehen, kein einziges Auto kam vorbei. Alles wirkte wie vergessen.
Ein Stück voraus lag ein kleiner Teich mit Bäumen, ähnlich wie in Schönhagen an der Grünen Insel. Auch Bänke waren dort – und eine Bushaltestelle! Ich lief hin, überflog den Fahrplan. Die Linie führte tatsächlich nach Schönhagen! Dann die Ernüchterung: Samstags ging der letzte Bus um sechs, und jetzt war es halb acht.
‘Wär ja auch zu schön gewesen’, dachte ich und ließ mich enttäuscht auf eine der Bänke fallen. Mein Kopf war auf einmal völlig leer, die Füße taten mir höllisch weh, meine Kehle war wie ausgedörrt. Auch meldete sich jetzt der Magen mit lautem Knurren – meine letzte Mahlzeit lag Stunden zurück. Ich musste dringend etwas einwerfen, sonst klappte ich demnächst zusammen. Zu blöd, dass ich keine Verpflegung mitgenommen hatte. Bei meinem fluchtartigen Aufbruch hatte ich an so was natürlich nicht gedacht.
An einem der Häuser auf der anderen Straßenseite hing eine Langnese-Fahne. Konnte das vielleicht ein Kiosk sein? Mit letzter Kraft schleppte ich mich hin. Aber die Tür neben der Fahne war eine normale Haustür, von einem Kiosk keine Spur. Ich drückte trotzdem den Klingelknopf – wahrscheinlich aus purer Verzweiflung.
Einige Sekunden vergingen, dann hörte man schlurfende Schritte. Die Tür öffnete sich und eine ältere, stämmige Frau im Kittel stand vor mir. Sie zwinkerte kurz hinter ihren dicken Brillengläsern und stieß ein knappes „Moin!“ aus.
„Äh, ich hätte gerne eine Cola“, stotterte ich. „ Und eine Tafel Schogetten. Vollmilch.“ Bestimmt würde es nun eine Standpauke setzen, von wegen Ruhestörung, Betteln und so. Vielleicht ließ sie sogar ihren Köter auf mich los. Nein, nichts von alledem: Sie drehte sich wortlos um und wackelte ins Haus zurück. Ich sah, wie sie den Eisschrank öffnete und eine Literflasche Cola herausfischte. Dann nahm sie eine Tafel Schokolade aus einem Regal und kam mit den Sachen zurück. Mit ihren Wurstfingern machte sie eine Zwei. Ich drückte ihr das Geld in die Hand. „Man dankt“, sagte sie, dann fiel die Haustür wieder ins Schloss.
Verdattert kratzte ich mich am Kopf. Hatte die Alte mir gerade Zeugs aus ihren Privatvorräten verkauft? Oder war dieses Haustürgeschäft das, was man hier draußen unter „Kiosk“ verstand? Dann spürte ich die kalte Flasche in der Hand, und alles andere war vergessen. Ich stolperte zurück zu meiner Bank. Wie herrlich es zischte beim Öffnen des Drehverschlusses! Welch ein Genuss, die kalte, sprudelnde Flüssigkeit in sich hineinlaufen zu lassen! Dazu die Schokolade – es war das pure Schlaraffenland. Hinterher saß ich mit kugelrundem Bauch dort und war einfach nur glücklich. Ich fühlte mich wie ein König nach dem großen Festmahl.
Blieb nur noch ein Problem: Wie kam ich von hier weg? Das Thema Bus hatte sich ja leider erledigt. Vielleicht trampen? Blöderweise wollte noch immer kein einziges Auto vorbeikommen. Dann doch bei Muttern anrufen? Aber das erschien mir wie eine Kapitulation – ich spürte, dass ich diesen Marsch aus eigener Kraft zu Ende bringen wollte. Selbst auf die Gefahr hin, dass es zwischenzeitlich dunkel wurde.
Also lief ich zu Fuß weiter, auf der Landstraße. Hinter dem Ort wurde die Gegend ziemlich flach, dazu hörte man jetzt fortwährend leises Rauschen, wie bei Wellengang. Näherte ich mich der Küste? Mein Blick wanderte über die Felder und streifte weit voraus, fast am Horizont, etwas Helles, das ich erst nicht beachtete. Dann machte es in mir ‘klick’: Das Ferienzentrum! Schneeweiß ragten die Türme aus dem Grün der Felder auf; hinter ihnen sah man das schmale, graublaue Band der See.
Jetzt wurde ich sehr schnell. Wo das Ferienzentrum war, konnte das Dorf nicht mehr weit sein. Und wirklich tauchte es wenig später auf, jenseits einer weitläufigen Niederung, in der ein Bach floss. Die Perspektive war ungewohnt: Die roten Backsteinhäuser und der zwiebelförmige Kirchturm in ihrer Mitte wirkten von hier wie ein kompaktes Nest, das in der Landschaft lag. Alles schien zum Greifen nahe.
Hinter einer langgezogenen Kurve wurde ein gelbes Ortsschild sichtbar: „Schönhagen“. Der schwarze Schriftzug war deutlich zu erkennen, trotzdem rieb ich mir beim Vorbeigehen immer wieder ungläubig die Augen: Ich war da, hatte es tatsächlich geschafft!
***
Der Ort begann, winzige Häuschen reihten sich eins an das andere. Ich kannte den Weg von einem Spaziergang, den ich mit der Clique gemacht hatte, und wusste deshalb, dass ich in der Nähe des alten Kerns war, dem „Dorf“. Weiter vorn würde der Asphalt in holpriges Kopfsteinpflaster übergehen. Die Dorfstraße machte dort einen Bogen nach links und überquerte den Mühlenbach. Gleich neben der Brücke lag die historische Wassermühle. Dann ging es bergauf, vorbei an der Kirche und dem alten Pfarrhaus mit seinen historischen Glaslaternen rechts und links der Tür. Hinter dem Bahnübergang zweigte eine Straße in unsere Siedlung ab, der Eichkamp.
Aber inzwischen wusste ich auch, dass es ein Umweg war, so zu laufen. Wer sich auskannte, nahm von hier die Abkürzung durch die so genannte „Schwedenhaus-Siedlung“. Bald war ich ausschließlich von roten Holzhäusern in schwedischem Baustil umgeben. Sie waren nach dem Krieg eilig hochgezogen worden, um Flüchtlinge aus den Ostgebieten unterzubringen. Aus dem Provisorium war über die Jahre ein Dauerzustand geworden. Inzwischen hatte man sogar die ersten Häuser renoviert.
Die Straße wurde zu einer Allee, die Kastanien auf beiden Seiten blühten bereits. In ihren Kronen tummelten sich wahre Heerscharen von Vögeln, deren Gezwitscher die abendliche Stille erfüllte. Ohne Probleme fand ich den Trampelpfad, der hinter den Garagen entlanglief und direkt zur Straßenecke mit dem Telefonkasten führte. Man sparte sich dadurch den unnötigen Bogen über Achterkamp und Kleiststraße.
Wieder ein kurzer Moment des Unglaubens, als ich am blauen Schild mit dem Schriftzug „Eichendorffstraße“ vorbeiging. Ich kam zur Hausnummer 12, wo Kristina und Silke wohnten. Vor dem Eingang Nr. 14 war Bernds Karre aufgebockt. Also war er am Donnerstag wohlbehalten zurückgekommen. Dann öffnete ich das Gartentor unseres Grundstückes. Ich ging durch den Vorgarten, schloss die Haustür auf.
Im Flur der vertraute Geruch nach Putzmitteln und ein bisschen nach Essen. Die Küche sah aus wie unberührt. Nirgends stand schmutziges Geschirr herum, die Arbeitsflächen waren gewienert, die Herdplatten erstrahlten in frischem Glanz. Und auf dem Küchentisch prunkte ein großer Strauß Blumen. Erstaunt und verwirrt blickte ich mich um. Ich hatte das Gefühl, als würde ich hier alles zum ersten Mal sehen.
Die Wohnzimmertür öffnete sich, Muttern kam heraus. „Schon wieder hier?“ Sie wunderte sich, fragte aber nicht weiter nach. Ich hatte gesagt, dass ich wahrscheinlich am Montag zurückkommen würde, vielleicht aber auch früher.
„Hast du Hunger?“, fragte sie. „Soll ich irgendwas machen?“
Das hatte sie mir noch nie angeboten. Träumte ich vielleicht? Passierte das alles hier gar nicht wirklich? Es war ähnlich wie an jenem Morgen kurz vor Weihnachten.
Hunger hatte ich keinen, noch immer lag mir die Schokolade wie ein Wackerstein im Magen. Aber ich war durchgefroren und sehnte mich nach etwas heißem zu trinken. Ganz vorsichtig, eher fragend als bittend, brachte ich heraus: „Vielleicht einen Caro-Kaffee?“
„Ja, gut“, sagte sie und legte tatsächlich los. Ich stand bloß da, konnte es nicht glauben.
„Bring schon mal deine Sachen hoch“, meinte sie, während sie herumhantierte.
Mein Zimmer war ausgelüftet, der penetrante Geruch nach kaltem Zigarettenrauch vertrieben. Die Klamotten, die normalerweise überall rumlagen, waren weggeräumt. Ich schmiss den Rucksack aufs Bett und ging wieder nach unten.
In der Küche duftete es mittlerweile nach Kaffee. Auf der Arbeitsfläche unterm Fenster standen zwei Becher, aus denen es dampfte. „Hab’ mir auch einen gemacht“, meinte Muttern. „Wie war’s denn so in der alten Heimat? Steht noch alles?“
Ich nickte und trank in kleinen Schlucken, blies zwischendurch immer wieder den Dampf weg, der mir in die Augen stieg. Angenehm warm breitete sich die Flüssigkeit in der Magengegend aus.
Draußen im Vorgarten sah man die ersten Blumen sprießen. Die Wiese auf der anderen Straßenseite war verwaist. An den warmen Tagen hatten dort Scharen von Kindern gespielt. Links an der Ecke waren die Einfamilienhäuser. In einem von ihnen wohnte der dreckige Michael.
Seit meiner Rückkehr hatte ich noch nicht eine Menschenseele auf den Straßen gesehen. Und dennoch wirkte nicht mehr alles tot auf mich, wie noch vor wenigen Tagen, sondern irgendwie… friedvoll. Wie schlafend.
***
Am nächsten Tag wollten Muttern und Henri nach dem Mittagessen eine Radfahrt machen. Es sollte zum Ferienzentrum gehen, dann durch die Salzwiesen weiter zum Strand, schließlich durch den Wald zurück. Sie boten mir an, mitzukommen.
Das Ferienzentrum… was, wenn mir dort die beiden Kerle vom Vortag über den Weg liefen? Aber der Gedanke ließ mich inzwischen kalt. Die konnten mir gar nichts. Warum ich nicht vom Klo zurückgekommen war? Das war ja wohl mein Problem! Hatten sie den Weg nicht auch ohne mich gefunden? Na also!
Dass sie Drogenkuriere gewesen waren, glaubte ich auch nicht mehr. Toms Paket konnte sonst was enthalten haben. Und die Knarre im Handschuhfach war garantiert bloß Aufschneiderei gewesen. Mittlerweile wurmte mich etwas ganz anderes: dass ich solche Panik bekommen hatte. Zum Glück war kein Bekannter im Auto gewesen, der mich hätte sehen können. So viel war klar: Niemand durfte jemals von dieser Sache erfahren!
Am Ende ließ ich mich überreden, auf die Radtour mitzukommen. Und stellte unterwegs fest, dass ich die Strecke bereits kannte: Es war dieselbe, die ich mit der Clique gelaufen war, beim Ausflug zum Gutshof. Allerdings war der Matsch auf den Feldwegen mittlerweile abgetrocknet und plattgewalzt, es ließ sich prima darauf fahren. Das Wetter war ähnlich wie gestern: kühl, aber nicht kalt, bedeckter Himmel, aber keine Regengefahr. Hinter dem Wäldchen, in dem ich mir neulich die Schuhe notdürftig saubergemacht hatte, kam bald der Abzweig zum Gut, dann tauchte am Horizont das Ferienzentrum auf. Selbst per Fahrrad dauerte es noch eine ganze Weile, ehe wir uns den weißen Betontürmen näherten – kein Wunder, dass Bernd neulich die Geduld verloren hatte.
Irgendwann erreichten wir eine Siedlung, wie sie auch in der Nordstadt hätte stehen können: Neubaublöcke, alle zwischen fünf und zehn Etagen hoch, gleichmäßig auf einer weiten Grasfläche verteilt. Über den Haustüren hingen große Plastikschilder mit Aufschriften wie „Kombüse“, „Brücke“ oder „Krähennest“. Erst wunderte ich mich, aber irgendwann fiel der Groschen: Man hatte den Häusern Namen verpasst, um sie auseinanderhalten zu können. „Ist hier alles schon Ferienzentrum“, erklärte Muttern. Benachbarte Blöcke waren durch Schutzdächer aus Beton miteinander verbunden, unter denen man Strandkörbe sah, ganze Batterien, abgedeckt mit Schutzplanen. „Werden den Winter über hier gebunkert“, wusste Henri zu berichten. „Aber bald kommen sie raus. Macht die Freiwillige Feuerwehr.“
Die Feuerwehr? Konnte das stimmen? Seit wann waren die für Strandkörbe zuständig? Eine weitere Merkwürdigkeit neben den vielen anderen, die mir hier bereits untergekommen waren. Ich stellte mir Jürgen in seiner schnieken Uniform vor, wie er eine Horde Pökse herumkommandierte, die sich mit den Körben abschleppen mussten.
Schließlich kamen wir an einen zentralen Platz. Die vier Türme ragten jetzt unmittelbar vor uns auf. Sie wirkten gigantisch, hatten bestimmt so viele Stockwerke wie die Weißen Riesen in der Nordstadt. Muttern meinte, sie würden eine Kurklinik und ein Hotel beherbergen. Auf dem Platz war es rappelvoll, Trauben von Ausflüglern schoben sich über das rote Klinkerpflaster. Ringsherum gab es Supermärkte, Ramschboutiquen, Fressbuden. Alle Läden hatten geöffnet, trotz des Feiertages.
Wir folgten einfach dem Menschenstrom, der sich auf das Hauptportal zubewegte. Drinnen erwartete uns eine Galerie mit weiteren Läden und Cafés, in der Tiefe war eine tropische Gartenlandschaft angelegt. Palmen und andere, fremdartige Gewächse schossen in die Höhe, reichten mit ihren riesigen, knallgrünen Blättern manchmal bis zur Brüstung. Inmitten der Pflanzenpracht glänzten die Wasserspiegel zahlreicher Teiche. Sie waren an ihrem Grund beleuchtet, einige hatten kleine Fontänen.
„Ich spendier ein Stück Ostertorte“, verkündete Muttern großmütig. Henri fand ein freies Tischchen etwas abseits des Trubels für uns. Während er und Muttern die Kuchenkarte durchblätterten, fuhr ich fort, die Leute auf der Galerie zu beobachten. Viele beugten sich übers Geländer, blickten fasziniert auf den künstlichen Dschungel dort unten. Ob die Mädchen aus dem Dorf auch manchmal herkamen? Vielleicht waren sie just in diesem Augenblick auf der Galerie unterwegs, zusammen mit irgendwelchen Verwandten. Kaum hatte ich diesen Gedanken, stieg in mir wieder dieses eigenartige Gefühl hoch, die gespannte Erwartung…
„Suchst du was?“, hörte ich plötzlich Muttern fragen.
„Äh, wieso?“, stammelte ich, leicht verwirrt.
„Du hast gerade so angestrengt geguckt.“
„Quatsch“, murmelte ich und wandte mich schnell woanders hin.




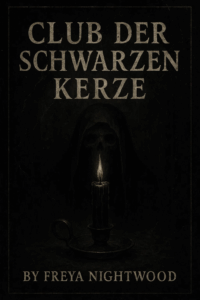

























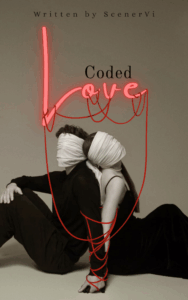



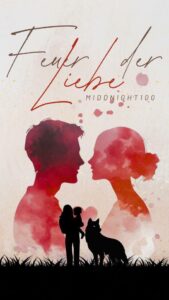






Kommentare