Kapitel 9 – Rettung aus der Finsternis

Kapitel 9 – Rettung aus der Finsternis
Rjna
War ich jetzt endlich tot? Es war dunkel. Aber … ich hatte mich nicht verabschieden können. Hatte Fredi nicht wiedergesehen. Eine unsägliche Traurigkeit machte sich in mir breit, bereit, mein Innerstes restlos einzunehmen. Was mache ich denn jetzt? Hier war absolut nichts! War das der Tod? Das Nichts? Würde ich jetzt auf ewig hier verweilen? Auf ewig allein? Ich hatte gehofft …
„Du hast auf deine Schwester gehofft.“
Erschrocken drehte ich mich um die eigene Achse, fand allerdings nichts als Schwärze vor. Ich wusste nicht einmal, worauf ich da eigentlich stand. Denn da, zu meinen Füssen, war genauso wenig etwas wie sonst wo! Hatte ich mir schon wieder etwas eingebildet? So wie auch Fredi in der Zelle? In der sie offensichtlich nicht gewesen sein konnte, wenn man Grinsebacke Glauben schenkte. Hatte er mich also tatsächlich getötet? Es war wirklich vorbei.
„Nicht ganz.“
Wieder fuhr ich herum, doch auch dieses Mal war niemand zu sehen. Diese Stimme. Sie schien gestaltlos. Geschlechtslos. Emotionslos. Weder tief noch hoch. Weder warm noch kalt. Sie war einfach. Dann ertönte ein Lachen. Es war weder als herzlich noch als böse zu beschreiben. Es war einfach ein Lachen. Gefühlskalt würde es vielleicht treffen.
Weiter und weiter suchte ich, doch da war schlichtweg nichts! Und auch die Stimme blieb stumm. „Was mache ich hier? Bringst du mich zu Fredi? Kannst du mich zu meiner Schwester bringen?“, schrie ich verzweifelt in die Leere hinein.
„Nein.“
Da! Es hatte wieder gesprochen! Nur war das keine sehr befriedigende Antwort. Und erneut kerte Stille ein. Immer wieder versuchte ich, die Stimme zum Reden zu bringen, doch es war hoffnungslos. Sie sprach nur, wenn sie es wollte. Es musste einige Zeit vergangen sein, doch nur mit Dunkelheit als Anhaltspunkt … nun, an diesem Punkt war ich ja schon einmal gewesen.
Dann ergriff mich ein Schmerz. Kein zwangloser, leicht abzutuender Schmerz. Keiner, den man einfach wegatmen konnte, wie so viel anderes. Nein, ein Schmerz, der alles übertraf, was ich je erlebt hatte! Die Bisse Dregos waren nichts dagegen! Doch ich konnte nicht schreien. Ich konnte meinem Schmerz keinen Ausdruck verleihen.
Durch den dichten Schleier des Schmerzes hörte ich noch die verzerrten Worte: „Pass auf dich auf, junge Rjnaria.“
Panisch erwachte ich. Zu meinem Entsetzen, hatte sich der Schmerz, nur noch gesteigert. Jede Faser meines Körpers schien zu brennen. Es war dunkel, aber die Stimme, diese fremde Präsenz war nicht mehr hier, das spürte ich. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Ausharrens und Ertragens liess der Schmerz ganz langsam nach.
Ein befremdliches Gefühl machte sich in mir breit, doch noch ehe ich es ergründen konnte, drohte ich zu ersticken und schnappte verzweifelt nach Luft. Wie ich zu meinem Entsetzen kurz darauf feststellen musste, befand ich mich unter der Erde. Untendrunter! Hatte man mich begraben? Lebendig? Nein, er hatte mich doch getötet! Jetzt war ich vollends verwirrt.
Durch meine Panik und den verzweifelten Versuch meine Lungen mit Luft zu befüllen, füllte sich mein Mund mit einem Haufen Erde. Doch abgesehen von dem bedrückenden Engegefühl in meiner Brust passierte nichts. Tatsächlich fehlte mir der Atem nicht wirklich. Ich hatte nicht das Gefühl zu ersticken und das, obwohl ich mir der Erde und der fehlenden Luft mehr als bewusst war. Da war nur das Gefühl von Unsicherheit und Angst, welche meinen Magen dazu bringen wollten, sich umzudrehen.
Einen Moment verblieb ich in einer Art Schockstarre, dann strample ich so lange mit jeglichen, mir zur Verfügung stehenden Gliedern, bis ich von der Erde über mir befreit war und einen Blick auf die sternenklare Nacht werfen konnte.
Ein wahrlich schöner Anblick, um nicht zu sterben.
Zuletzt hatte ich den Sternenhimmel vor drei Jahren gesehen. Den Himmel, den Mond und die unzähligen, kleinen, hellleuchtenden Sterne. Aber auch die frische Luft um mich herum fühlte sich ungewohnt an auf meiner Haut. Weder besonders kalt noch warm. Doch trotz des Anblicks und auch der Tatsache, offenbar nicht atmen zu müssen, war es keineswegs angenehm, einen Mund voller Erde und Dreck zu haben, sodass ich diese schnell ausspuckte.
Verwirrt setzte ich mich aufrecht hin und sah mich um. Sitzen tat ich offenbar in einer kleinen Mulde. Nicht tief genug für ein richtiges Grab, mehr eine kleine Einbuchtung im Waldboden. Um mich herum, wie auch nicht anders zu erwarten, Wald. Der Mond erleuchtete den Grossteil meiner Umgebung und die Sterne taten das Übrige. Dennoch drang ihr Licht nur gedimmt durch das dichte Blätterdach. Es war wirklich eine wunderschöne Nacht. Da könnte ich glatt für den Rest meines Lebens liegenbleiben und in den Himmel hinauf starren. Wie konnte das sein? Bildete ich mir das auch wirklich nicht ein?
Nach wenigen Momenten des untätigen Herumsitzens tauchten plötzlich ein paar Bilder vor meinem inneren Auge auf. Grinsebacke wie er sich über mich lehnte und mir Worte zuflüsterte. Eine Entschuldigung. Genral. Er sprach vom verfeindeten Nachbarsland Mornems. Aurelius.
Was war nur passiert? Hatte mir Grinsebacke etwa da rausgeholfen? Das … das glaubte ich nicht. Andererseits hatte er mich hier draussen offenbar mir selbst überlassen.
Schlagartig fanden meine Hände meine schmerzhaft pochenden Schläfen. Mit Nachdenken war wohl noch nichts. Ich brauchte dringend etwas zu Essen. Dieser Gedanke liess mich hysterisch auflachen. Ja klar. Essen. Im Wald, mitten im Nirgendwo, gab es auch sicher einen leckeren Auflauf. Aber eigentlich hätte mir eine magere Suppe ja schon gereicht … Mein Magen stimmte knurrend zu.
Langsam kam ich auf die Beine, wobei ich mich mit den Händen an einem Baumstamm abstützte und hochzog.
In Ordnung, Rjna. Alles wird gut. Du brauchst nur wieder etwas, um zu Kräften zu kommen. Und dann … dann überlegst du dir, was … tja … was.
Was machte ich jetzt mit meinem Leben? Meine Familie war allem Anschein nach tot. Ehrlich gesagt tangierte mich das beim Gedanken an Vater und Mutter nicht die Bohne. Aber Fredi. Sie hatte das wirklich, wirklich nicht verdient.
Mich vom einen zum nächsten Baum stützend, bewegte ich mich langsam und kontinuierlich in eine Richtung. Es gab keinen Weg, an dem ich mich hätte orientieren können. Es wäre sogar, sollten mich alle guten Geister verlassen, möglich, dass ich direkt wieder in die Arme meiner Peiniger lief. Bitte nicht. Ich hatte eindeutig kein Verlangen danach, weitere drei Jahre als Lord Dregos Sklave zu dienen. Ich bezweifelte, dass ich das noch einmal überleben würde.
Mein Kopf pochte unangenehm und raubte mir auch das letzte Verständnis für meine Umgebung. Alles um mich herum war schrecklich laut. Deshalb pochte mein Kopf auch so! Da war eine riesige Geräuschkulisse und ich konnte nichts zu irgendwas zuordnen! Es war, als lege sich ein betäubendes Rauschen über meine Ohren, welches diesen jeglichen Nutzen nahm. Zudem wurde mein Kopfschmerz immer schlimmer.
Hatte ich nicht Fieber gehabt? Jetzt offenbar nicht mehr. Das Krankheitsgefühl war verschwunden und das Gefühl, innerlich zu verbrennen, ebenfalls. Daher war das gerade meine geringste Sorge. Schwer schnaufend lehnte ich mich an den nächsten Baum und führte meine Hand zur Stirn. Mein Körper war noch immer leicht erhitzt, aber ich war immer schon wärmer gewesen als andere. Das kam mir im Moment zugute, denn ich war noch immer ohne jegliche Bekleidung und die Wetterlage lud zum Frösteln ein.
Da ich nur sehr schleppend vorwärtskam und noch immer nichts Essbares gefunden hatte, musste ich durchhalten. Das schaffte ich genau so lange, bis die Sonne sich am Horizont zeigte. Als ihre ersten Strahlen mein Gesicht berührten, war es nicht wie sonst, wo ich die wohlige Wärme der Sonne spürte und geniesserisch in mich aufnahm. Es fühlte sich ein bisschen so an, wie ich mir mein nächstes Bad im Fluss vorstellte. Nach drei Jahren Kerkeraufenthalt würde ich mir die Haut vermutlich vom Körper kratzen müssen, bis ich wieder sauber war.
Und so fühlte sich auch die Sonne an. Als würde sie mir die Haut von den Knochen brennen. Und auch wenn sich das jetzt eher schlecht anhörte, so fühlte es sich zu gleichen Teilen schmerzhaft und grandios an. Reinigend, auf eine Art und Weise.
Ganz anders jedoch bei meinen Augen. Als das grelle Licht auf meine Augen traf, zischte ich auf, das Gesicht zu einer Maske des Schmerzes verzerrt. Meine Augen hatte ich zusammengekniffen, dennoch spürte ich noch immer die unzähligen kleinen Nadelstiche, die die Sonne in meine Augen gebrannt hatte. Doch auch das Licht, welches nun durch meine geschlossenen Lieder drang, war zu hell, zu blendend, sodass ich mir zusätzlich noch einen Arm vor die Augen hielt.
Dank der ganzen Sinnesüberflutung landete ich schliesslich unsanft und mit einem kleinen Aufschrei auf dem weichen Waldboden. Verdammt, was war denn heute los?
Stöhnend richtete ich mich wieder auf und klopfte den Dreck von meinem Körper. Wieso nur war ich allein? Was sollte ich denn jetzt tun? Ich wusste überhaupt nicht, wie man so überlebte! Im Dorf hatte ich nie gejagt! Das war nicht Aufgabe der Frauen.
Enttäuscht entfuhr mir ein Seufzen. Wie sollte ich denn so überleben? Wenn ich nicht innert eines Tages zufällig auf mir gut gesinnte Leute träfe, hätte mir mein bisheriges Überleben genau gar nichts gebracht. Dann wäre ich nämlich zu schwach, um noch weiterzugehen.
Plötzlich vernahm ich ein Geräusch, direkt hinter mir, in den Dichten des Waldes. Erschrocken drehte ich mich zu dem Geräusch hin und setzte einen Schritt zurück, wobei ich über eine Wurzel stolperte und mich schon wieder auf dem Waldboden wiederfand. „Verdammt!“, zischte ich und schaute entnervt auf meine aufgeschürften Hände. Es war nicht weiter schlimm, aber hätte auch nicht sein müssen.
Irritiert schaute ich auf, zu dem Ort, an dem ich das Geräusch vernommen hatte. Als sich dort nichts rührte, richtete ich mich vorsichtig wieder auf und überwand mich schliesslich, nachzusehen. Ich fast meinte ich, mein Herz in meiner Brust schlagen hören, vor lauter Aufregung. Fast. Doch als ich ins Gestrüpp stieg, um nachzusehen, war da nichts. Ein leichter Geruch von etwas, aber ich konnte es beim besten Willen nicht zuordnen.
Erschöpft machte ich mich wieder auf den Weg – einen Arm über meinen Augen positioniert, sodass die Sonne sie nicht direkt traf. Lange würde ich nicht mehr laufen können. Mir ging die Kraft aus. Und als es schliesslich dunkelte, liess ich mich mit einem schweren Keuchen zu Boden gleiten. An meinen Füssen prangten Blasen und meine Beine wären demnächst zweifellos unter mir weggeknickt. War’s das jetzt? Schon wieder?
Einen Moment lang sass ich einfach nur da, meinen Rücken an einen Baum gelehnt, meinen Arm weiterhin vor meinem Gesicht drapiert. Ich hatte keine Kraft mehr. Mit einem leisen Schluchzen liess ich mein Gesicht in meine Hände sinken, die ich wiederum auf meine angewinkelten Beine legte. So hing ich sicher eine halbe Stunde meinen Gedanken nach, bis ich ein weiteres Knacken vernahm.
Erst hob ich erschrocken den Kopf, doch dann vergrub ich ihn wieder in meinen Händen. Was hätte es für einen Sinn, nach der Ursache dieses Geräusches zu suchen? Eine Möglichkeit wäre, dass mir dieses, was auch immer da war, wohl gesonnen wäre und mir helfen würde. Die viel wahrscheinlichere Möglichkeit allerdings war das genaue Gegenteil. Denn in diesem Fall würde ich überfallen, missbraucht oder, im gnädigsten Szenario, einfach endlich getötet werden. Wehren konnte ich mich sowieso nicht, dafür war ich mittlerweile zu schwach. Nicht dass ich mich getraut hätte, je meine Hand gegen einen Mann zu erheben.
Und so spielte es auch keine Rolle, ob ich erst ins Gestrüpp kletterte, um nachzusehen, oder einfach hier in Ruhe sitzen blieb und meine letzten Momente in Frieden und Stille verbrachte. In meinem eigenen kleinen Raum, den ich mir mit meinen Armen schuf. Es gab mir schon beinahe ein heimeliges Gefühl, und dieses wollte ich ungern so kurz vor meinem Tod missen. Es war auch das Einzige, was mich, wenn man das denn noch behaupten konnte, in der Zelle bei Verstand gehalten hatte. Meine eigene Umarmung. Andere fänden es lächerlich. Für mich war es meine Rettung in der Finsternis.
Ich hatte mich eingekugelt, aufgegeben und schwebte nur noch am Rande meines Bewusstseins. Ich hatte keine Energie mehr. Der Wald um mich herum sang ruhig sein abendliches Lied, der Wind blies leise durch die dichtgesähten Blätter.
Unversehens drang eine Stimme durch die dichtstehenden Bäume: „Gibst du schon auf?“
Mein Kopf schreckte aus meinen Armen hoch und meine Atmung beschleunigte sich. Als ich meinen Blick durch die Bäume um mich herum gleiten liess, wurde ich jedoch, wie auch schon bei dem Geräusch zuvor, natürlich nicht fündig. Nur war es dieses Mal nicht nur ein beliebiges Geräusch gewesen, sondern eine Stimme! Es musste also ein Mensch da sein! Nur …
Resigniert steckte ich meinen Kopf wieder zwischen meine Beine. Sollte er mich doch töten. Die Stimme war unverkennbar die eines Mannes. Samtig, wenn ich sie beschreiben sollte. Eine Stimme, zu der man am Abend, wenn man vor dem knisternden Feuer sass, einer Geschichte lauschte und vielleicht sogar langsam schläfrig wurde.
Ich blinzelte. Als ich meine Augen wieder öffnete, erblickte ich ein Paar Stiefel vor mir. Geschockt hielt ich den Atem an. Ich war nicht darauf gefasst gewesen, dass er sich mir ohne Vorwarnung näherte. Sollte ich aufsehen? Oder ihn ignorieren? „Einfach wieder gehen werdet Ihr wohl nicht?“, nuschelte ich brüchig, obschon es eigentlich nicht einmal das war, was ich wollte. Er könnte mir vielleicht helfen. Jedoch war mein Vertrauen in die Gutmütigkeit anderer Personen mit meiner Schwester gestorben.
Er musste meine Aussage lustig finden, denn er gab ein amüsiertes Geräusch von sich und schüttelte den Kopf, was ich bloss apatisch durch seinen vom Mondlicht geworfenen Schatten beobachtete. Seine Stiefel waren gross, was auch auf einen grossen Körperbau hinwies. Sie waren gut verarbeitet, so weit ich das beurteilen konnte. Die Stiche stammten von einem Schuhmacher, der sein Handwerk verstand und die aufwendigen Verzierungen wiesen auf einen sehr wohlhabenden Herren hin, der da vor mir stand.
Unweigerlich wanderte mein Blick etwas weiter nach oben. Seine Hose war nichts Spezielles, aber auch sie war gut geschnitten und hatte keinen Faden fehl am Platz. An der Hüfte prangte ein kleines Arsenal an Waffen, von denen ich, abgesehen von einem Dolch, noch keine je gesehen hatte. Allerdings wusste ich, dass es sich bei dem länglichen Teil um ein Schwert handelte.
Der Dolchgriff war mit feinsten Verzierungen versehen. Kleine goldene Strukturen durchzogen den schwarzen Stein des Griffes in filigranster Weise. Die Scheide bestand aus dunklem Leder, welches rau und robust wirkte. Das Schwert an seiner Hüfte war zweifellos ebenso elegant wie tödlich und stand dem Dolch vermutlich in nichts nach. Doch dieser hatte eine Anziehung auf mich, die ich so nicht kannte, und so zuckten meine Augen immer wieder zu ihm zurück. Zusätzlich fand sich noch ein Wasserschlauch an der Hüfte des Mannes festgebunden, an welchem meine Augen sehnsüchtig hängen blieben. Mein Zeitgefühl hatte ich verloren, aber ich hatte Durst!
Schweren Herzens riss ich meinen Blick von dem Wasserschlauch los und liess meine Augen weiter über den Mann vor mir wandern. Sein Hemd war etwas edler. Wie es ein Edelmann, vielleicht sogar ein Adliger trüge. Dafür hatte ich aber zu wenig Ahnung von Blaublütern. Zum oberen Ende hin, fand sich eine lockere Schnürung, mit deren Hilfe man das Hemd oben enger, oder lockerer machen konnte. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Das musste eine neue Mode oder dergleichen sein. Andererseits bekam man in einem kleinen Dorf wie dem meinem auch nicht wirklich etwas von der aktuellen Mode mit. Nicht, dass ich die letzten drei Jahre dort gewesen wäre.
An seinen Armen prangten Muskeln, die sogar durch das lockere Hemd nicht ansatzweise verdeckt wurden. Seine Statur war agil und doch muskulös. Ich hatte immer Vater als durchtrainiert angesehen. Jetzt wurde ich eines Besseren belehrt.
Um seine Schultern hing allem Anschein nach ein teurer Filzmantel. Auch der war teilweise mit ledernen Partien verziert, sonst aber relativ schlicht gehalten. Als ich mit meiner Musterung schliesslich bei seinem Gesicht ankam, trafen meine Augen die Seinen. So viel dazu, nicht hochzuschauen.
Sein Gesicht hatte weiche Konturen, die mir ein vertrautes Gefühl vermittelten, und feste, leicht geschwungene Augenbrauen thronten oberhalb unglaublicher Augen, in denen ich mich gerade verlor. Seine Iriden waren tiefrot und funkelten mich belustigt an. Erst jetzt fiel mir überhaupt sein Gesichtsausdruck auf. Eine seiner Augenbrauen war merklich hochgezogen und seine Lippen verzogen sich zu einem belustigten Grinsen, welches sich auch auf seinen gehobenen Wangen abbildete. Seine Augen funkelten schelmisch und wurden dabei von schulterlangem, blond-braunem Haar eingerahmt.
„Und?“, fragte er.
„Was?“, entgegnete ich leise, meine Stimme rau wie Sandpapier.
„Gibst du schon auf?“, wiederholte er seine Frage und schien belustigt. Was auch immer an meiner Situation lustig war.
„Ja“, krächzte ich nur müde zur Antwort und wandte den Blick wieder ab. Meinen Kopf legte ich seitlich auf meine Knie. Ich sollte ihn nicht ansehen. Es brächte mich nur dazu, unüberlegt zu handeln. Und das endete meist schmerzhaft. „Tötet mich“, bat ich ihn schliesslich, die Augen erwartend geschlossen, und hoffte inständig, er würde es einfach tun. Wieso war ich denn noch am Leben? Was hatte ich denn noch, wofür es sich lohnen würde, weiter zu leiden? Mein Körper schmerzte und mein Geist war ausgelaugt. Fredi war tot und ich hatte weder eine Aufgabe noch Familie, die mir Grund zu Leben gaben.
Schneller als wahrnehmbar war er vor mir in die Hocke gegangen und hatte mit einer Hand mein Kinn angehoben. Erschrocken keuchte ich auf. Keine Sekunde später echote mein Keuchen, nur dass es jetzt von ihm kam.
„Wer hat dir das angetan?“, richtete er das Wort nun deutlich ernster an mich. Jede Belustigung, jedes Amüsement war aus seinem Blick gewichen, als wären sie nie dagewesen. Ich meinte, in seinen Augen Fassungslosigkeit und Enttäuschung zu erkennen. Doch übertrumpft wurde beides im nächsten Moment von einem Ausdruck tiefsten Schmerzes, welcher wiederum von grenzenloser Wut abgelöst wurde. Dieselben Gefühle schwangen in seiner Stimme mit.
Nur, was meinte er? Die Narben? Das fehlende Essen? Die drei Jahre Gefangenschaft? Aber davon konnte er nichts wissen …
Im nächsten Moment spürte ich, wie ich in einen weichen Stoff eingewickelt und kurz darauf hochgehoben wurde. Vor Schreck krallte ich meine Hände mit aller Kraft in sein Hemd. Wenig später, als ich mir sicher war, dass er mich nicht gleich wieder fallen liesse, streckte ich die Arme aus und umfasste ganz wie von selbst seinen Nacken, was mir ein sicheres Gefühl vermittelte. Mein Gesicht schmiegte ich, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was ich da eigentlich tat, an seine breite Brust und genoss deren Wärme leise seufzend. Offenbar war ich mittlerweile doch leicht ausgekühlt. Beruhigt atmete ich seinen Geruch ein und stellte fest, dass es der gleiche war, wie den, den ich vorher im Wald wahrgenommen hatte. „Ihr wart das“, nuschelte ich noch, bevor ich schliesslich vollkommen entkräftet in seinen Armen einschlief.




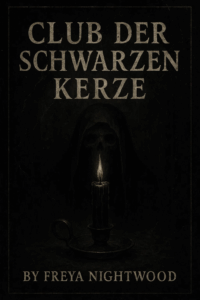






















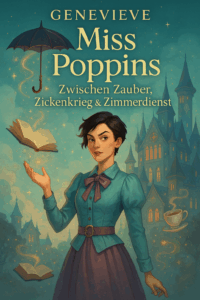

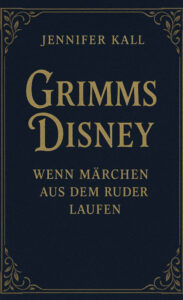
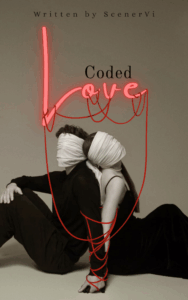

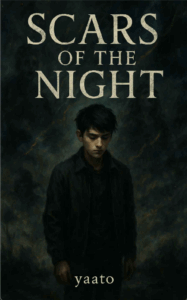




Kommentare