SdS – Kapitel 1
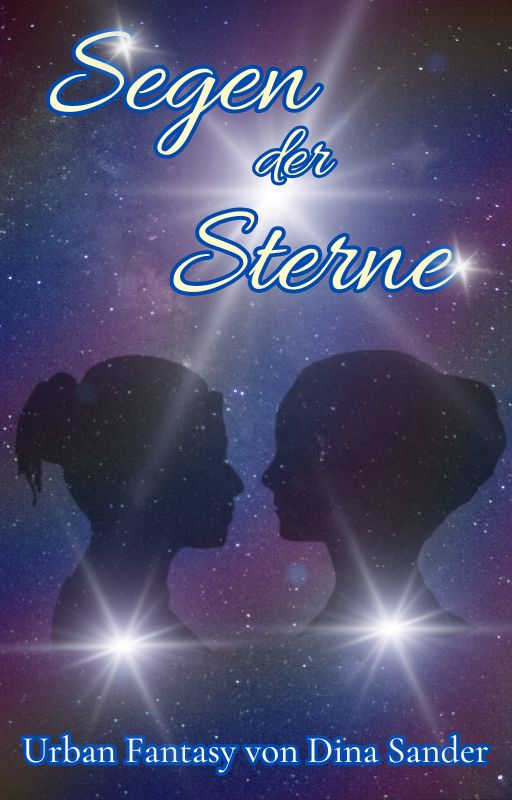
Die Luft im kleinen, stickigen Büro roch leicht süßlich nach dem Parfüm von der Frau, die vor mir hier drin gewesen war. Außerdem drang ein unangenehmer Geruch von Zigarette bis an meine Nase, übertüncht von Minzpastillen. Aber ich würde auf gar keinen Fall etwas dazu sagen. Immerhin saß ich auf der falschen Seite des Schreibtisches. Ich war diejenige, die nichts zu sagen hatte. Die dankbar sein musste, wenn sie überhaupt eine eigene Meinung haben durfte.
Leicht nervös rutschte ich auf meinem Plastikstuhl hin und her. Doch Sekunden später hörte ich damit auf, als ich ein leises Knacken hörte. Das Plastik würde doch jetzt nicht unter meinem Hintern zerbrechen? So dick war ich nun echt nicht. Aber was wusste ich schon vom Alter dieses Stuhls? Vielleicht reichten meine Pfunde bereits aus, ihm den Rest zu geben.
Ich faltete meine Hände und bemühte mich, nicht mit den Daumen zu kreiseln. Ganz ruhig bleiben. Tief durchatmen und ruhigbleiben!
Mein Blick war starr auf die Schreibtischkante gerichtet. Ein winziger Kratzer im Kunststoff zog meine Aufmerksamkeit auf sich – ein perfekter Fluchtpunkt, während die Frau mir gegenüber meine Akte durchblätterte. Papier war in dieser Agentur wohl noch immer wichtiger als ein Computer. Aber auch dazu würde ich ganz sicher nicht meine Meinung äußern.
„Also, Frau …“ Die Arbeitsvermittlerin hob eine Augenbraue und sah auf den Bildschirm, ehe sie wieder zu mir blickte. „… Sommer. Fünfte Entlassung in Folge. Alle während der Probezeit.“
Ihre Stimme klang so emotionslos wie eine automatische Ansage im Fahrstuhl. Ich nickte nur stumm. Was sollte ich auch großartig dazu sagen? Es war für mich schlimm genug, dass ich es nie bis zum Ende der drei Monate schaffte. Obwohl ich so langsam das Gefühl hatte, die Leute nutzten mich aus. Sie lernten mich zwei Wochen an, danach arbeitete ich mit reichlich Überstunden für sie – und dann die Kündigung, die ja nicht wirklich eine war, es war eine Beendigung der Probezeit, weil es nicht gepasst hatte.
Die Arbeitsvermittlerin zog ihre Brille etwas nach unten, beugte sich vor und sah mir tief in die Augen. „Haben Sie gar nichts dazu zu sagen?“
Mein Herz schlug automatisch etwas schneller, mein Magen zog sich zusammen, und ich spürte, wie meine Handinnenflächen schweißnass wurden. Das passierte mir immer, wenn ich zu meiner persönlichen Meinung gefragt wurde. Dabei war klar, dass es meine neue Arbeitsvermittlerin nicht interessierte, was ich zu den Entlassungen zu sagen hatte. Sie wollte nur Ergebnisse sehen: mich erfolgreich loswerden, damit ihre Vermittlungsstatistik besser aussah.
„Nun?“, bohrte sie nach. Wollte sie etwa doch wissen, was ich dachte?
„I-ich glaube, äh, d-dass …“, brachte ich mühsam stotternd hervor, ehe ich schluckte und ängstlich lächelnd in die stechend blauen Augen von Frau Behrens sah.
„Ja, was glauben Sie?“, hakte sie nach, weil es ihr wohl zu lang dauerte, bis ich mit der Sprache raus war. Was erwartete sie von mir? Ich war doch keine geborene Rednerin, die Hoffnung auf eine Karriere in der Politik oder als Schauspielerin hatte. Ohne eine gute Vorbereitung war ich total hilflos. Und auf diese Frage war ich absolut nicht vorbereitet!
„Dass es einfach nicht gepasst hat“, stieß ich schnell heraus, ehe mein Verstand mich wieder ins Grübeln und damit auch zum Stottern brachte. Leider war die Antwort nicht unbedingt das, was meine neue Sachbearbeiterin bei der Agentur hören wollte.
„So, es hat nicht gepasst“, meinte sie, schob ihre Brille wieder hoch und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Sie hatte keinen billigen Plastikstuhl, der knackte. Sie saß auf einem hochlehnigen Drehstuhl mit Polsterung, der wahrscheinlich nicht einmal quietschte, wenn sie über den Boden rollte.
„Sie glauben also allen Ernstes …“ Sie lenkte ihren Blick erneut auf den Monitor, ehe sie weitersprach. „… Frau Sommer, dass es fünf Mal nicht gepasst hat. Sie haben sich also fünf Mal auf Stellen beworben, auf die Sie nicht passten?“
Es lief mir eiskalt den Rücken herunter bei diesem anklagenden Tonfall. Mein Puls raste, und in meinen Ohren begann es zu rauschen. Spürte ich da nicht schon vereinzelte Schweißperlen am Haaransatz und an den Schläfen? Hastig löste ich meine verkrampften Finger und fuhr wie zufällig über meine Stirn, als ob ich sie nachdenklich reiben müsste. Dabei stellte ich erleichtert fest, dass noch alles trocken war. Kein Schweiß, puh, das war schon mal gut.
„J-ja, äh, es scheint s-so.“
Frau Behrens richtete sich hoch auf, tippte auf ihrer Tastatur herum und blickte mit hochgezogener Braue auf ihren Bildschirm. „Ich sehe hier kein wirkliches Muster in den Begründungen, weshalb die Probezeit vorzeitig beendet wurde“, sagte sie und musterte mich kurz kühl, ehe sie erneut auf den Bildschirm blickte. „Aber ich sehe, dass Sie nicht besonders wählerisch sein sollten.“
Ich öffnete den Mund, um zu widersprechen, ein klitzekleiner Mutschauer überkam mich – aber dann klappte ich ihn wieder zu. Was würde es bringen, ihr das Muster zu erklären? Denn natürlich gab es eines: Ich war das Muster. Ich war das wandelnde Pech, das sich von Job zu Job schleppte, nur um immer wieder am selben Punkt zu landen: genau hier. Auf der falschen Seite vom Schreibtisch der Arbeitsvermittlung. Weil ich einfach nicht wusste, wie ich die Vorgesetzten davon überzeugen konnte, dass ich besser war als die anderen Probezeitkandidaten.
Ich verschränkte erneut meine Hände und knetete mit ihnen herum. Ich fühlte mich minderwertig und auch ein wenig schuldig. Eine Frau wie Frau Behrens könnte es niemals verstehen, wie sich eine Frau wie ich fühlte. Sie hatte eine Ausstrahlung, die jeden in die Knie zwang. Ihre braunen Haare waren zu einem ordentlichen Dutt frisiert, die schwarze Brille unterstrich ihre kühle Dominanz, das dunkelblaue Kostüm harmonierte perfekt mit den wasserblauen, durchdringenden Augen. Sie war groß, schlank und alles, was ich nicht war.
Das Rattern des Druckers riss mich aus meinen Gedanken. Schon schob mir Frau Behrens einen Stapel Ausdrucke hinüber. „Hier sind einige Stellenangebote. Ich erwarte, dass Sie sich auf jedes Einzelne davon bewerben.“ Wieder beugte sie sich leicht vor und sah mich über den Brillenrand hinweg an. „Sie werden von jeder Bewerbung eine Kopie machen und mir zusenden. Und ich will von jeder Absage ebenfalls eine Kopie erhalten. Wenn Sie bis nächste Woche keinen Job haben, kommen Sie wieder herein und holen sich die nächsten Stellenangebote ab. Außerdem erwarte ich, dass Sie selbst im Internet nach passenden Angeboten Ausschau halten und sich bewerben.“
Ich griff nach den Blättern und blinzelte ein paar Mal, die Buchstaben verschwammen vor meinen Augen, so aufgeregt war ich. Regalbefüllerin. Lagermitarbeiterin. Kommissioniererin. Noch eine Regalbefüllerin. Und noch eine Lagermitarbeiterin. Kein Stellenangebot hatte mit meiner Ausbildung zu tun.
Mein Magen zog sich zusammen. Ich war Einzelhandelskauffrau. Ich hatte eine Ausbildung gemacht. Ich hatte gelernt, Kunden zu beraten, Kassen zu bedienen, Verkaufsflächen zu gestalten. Ich wollte keine Kartons schieben oder Dosen in Reihen stapeln, bis mir der Rücken wehtat.
„I-ich …“
„Ja?“ Die Augen von Frau Behrens wurden kleiner und wirkten so noch stechender auf mich. „Gibt es ein Problem? Ich habe in Ihren Unterlagen gesehen, dass Sie einen Führerschein haben, also dürfte es für Sie im Bereich des Möglichen sein, sich im näheren Umkreis von zwanzig Kilometern zu bewerben.“
Mein Blick huschte erneut auf die Blätter. Ich hatte noch gar nicht auf die Adressen gesehen. Tatsächlich, die Frau schickte mich in einem Umkreis von zwanzig Kilometern auf die Arbeitssuche – ihrem Umkreis. Dabei wohnte ich gar nicht hier, ich musste fünfzehn Kilometer mit dem Bus anreisen für einen Beratungstermin. Da waren Firmen dabei, die fast vierzig Kilometer von meinem Wohnort entfernt waren.
Aber ich sagte nichts. Stattdessen zwang ich meine Lippen zu einem angedeuteten Lächeln und nickte.
„Natürlich“, murmelte ich.
Frau Behrens nickte zufrieden und machte eine Notiz. „Gut. Dann erwarte ich nächste Woche Rückmeldung über Ihre Bewerbungen.“
Ich stand auf, steckte die Ausdrucke in meine Tasche und verließ das Büro mit einem seltsamen Gefühl in der Brust. Einem, das irgendwo zwischen Resignation und Wut lag. Wobei die Resignation wie immer überwog. Warum nur war ich so feige? Ich hatte kein Auto, und meine zwanzig Kilometer Umkreis waren nun einmal nicht ihre zwanzig Kilometer Umkreis. Außerdem war ich besser als eine Regalbefüllerin, ich konnte mehr, sonst hätte man mich nicht immer fast drei Monate beschäftigt und erst kurz vor Ende der Probezeit weggeschickt. Ich war gut, wirklich.
Seufzend stand ich vor dem Aufzug und drückte auf den Knopf, aber da tat sich nichts. Das Licht leuchtete nicht einmal. Zwar konnte ich nirgends ein Schild „Aufzug defekt“ finden, aber wahrscheinlich hatte er ausgerechnet jetzt irgendeinen Schaden. Ich ging zum Treppenhaus und machte mich auf den Weg nach unten. Zum Glück waren es nur fünf Stockwerke. Und zum Glück hatte der Aufzug noch funktioniert, als ich angekommen war. Und zum Glück war er nicht ausgefallen, als ich mit ihm gefahren war.
Mein Lächeln fiel etwas schief aus, als ich darüber nachdachte, dass ich so etwas schon als „Glück“ bezeichnete. Doch irgendwo musste ich nach Positivem suchen, sonst drehte ich noch durch.
Regalbefüllerin.
Als ich die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht hatte, war mir gesagt worden, dass ich auch im Büro arbeiten könnte, sogar in der Buchhaltung, wo ich aber gar nicht hin wollte. Doch ein netter Arbeitsplatz im Büro könnte mir schon gefallen. Am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Briefe oder Bestandslisten im Computer eintippen, das wäre wirklich richtig gut.
Und nun sollte ich Regale befüllen oder irgendwas im Lager arbeiten. Was arbeitete man überhaupt im Lager? Vielleicht sollte ich mich da mal erkundigen. Es konnte sein, dass es gar nicht so schlimm war, wie es klang.
Im zweiten Stock erkannte ich, warum der Aufzug „defekt“ war. Ein Mann in einem Anzug unterhielt sich mit einer schick gekleideten Frau, wobei er in der Tür zum Aufzug stand und diesen für den Rest des Hauses blockierte. Aber ich wagte es nicht, ihn darauf hinzuweisen, wie überaus unhöflich sein Verhalten war. Stattdessen ging ich weiter Stufe um Stufe durch das Treppenhaus nach unten. Vielleicht verlor ich sogar ein paar Pfunde beim Runtergehen.
Als ich im Foyer ankam und nach draußen sah, seufzte ich schwer.
Draußen nieselte es. Natürlich.









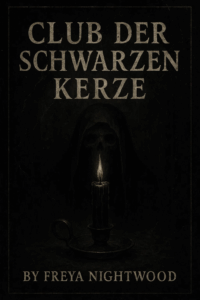




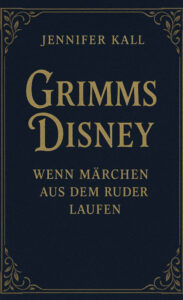










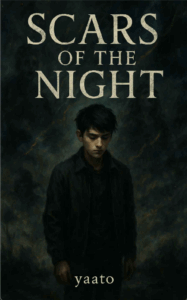






Kommentare