14. Landleben


Es blieb sonnig und warm, also traf ich mich weiterhin mit den Dorfleuten. Besser als Stubenhocken war das allemal. Aber ich hielt mich in der zweiten Reihe – hier lief alles so komplett anders als in der Nordstadt, da war es einfach schlauer, denjenigen den Vortritt zu lassen, die sich auskannten.
Einiges fand ich richtig schräg. Zum Beispiel machten alle Jungs aus dem Dorf bei der Freiwilligen Feuerwehr mit, das war wie ein ungeschriebenes Gesetz. Einmal pro Woche war Schulung auf der Feuerwache. Erst gab es Theorie, danach praktische Übungen. Leitern wurden bestiegen, Wasserschläuche ausgerollt und in Betrieb genommen. Alle waren voll bei der Sache, als würde es im Ernstfall wirklich auf sie ankommen.
Einmal ließ ich mich von Jürgen breitschlagen, an einer dieser Schulungen teilzunehmen. Er hatte wohl die Hoffnung, mich für das Ganze begeistern zu können, aber das konnte er vergessen. Der Typ war wirklich eine ganz komische Marke. Seinen Feuerwehr-Job nahm er superwichtig, er sprach immer von „Dienst“ und meinte das tatsächlich so. Vor ein paar Wochen war er rangmäßig aufgestiegen, durfte jetzt Übungen leiten, andere herumkommandieren und ähnliches. Seine dunkelblaue Uniform mit den vielen Streifen und Abzeichen liebte er über alles. In der Nordstadt wäre man eher gestorben, als in so was rumzulaufen. Ganz anders Jürgen: Er fühlte sich wie der Kaiser persönlich.
Seine größte Bewunderin hieß natürlich Silke. Ihre Augen klebten geradezu verzückt an ihm und seiner Uniform. Dass Jürgen sie und keine andere gewählt hatte, erfüllte sie sichtlich mit Stolz.
Überhaupt Jürgen und Silke – ein seltsameres Paar war mir noch nicht untergekommen. Seit sage und schreibe zwei Jahren waren sie schon zusammen, und angeblich hatten sie sofort von Heiraten gesprochen – dabei war Silke gerade mal 14! Nach außen versuchten die beiden zu wirken wie die Königspaare in den Hochglanzzeitschriften, genauso perfekt und makellos. Jürgen wohnte im Nachbarblock, und wie der Zufall es wollte, lagen sein Zimmer und das von Silke genau gegenüber. Jeden Abend stellte er eine Lampe mit roter Glühbirne ins Fenster. Sie war von überall zu sehen, auch ich hatte mich schon gefragt, was es damit wohl auf sich hatte. Mittlerweile wusste ich, dass er Silke damit „Ich liebe Dich“ sagen wollte. Und das war wirklich ernst gemeint.
Dass Kristina und Silke manchmal für Zwillinge gehalten wurden, hatte ich anfangs nicht verstanden. Es gab so viele Unterschiede zwischen ihnen. Silke war ein eher heller Typ, im Gegensatz zu Kristina, deren braune Haut tatsächlich leicht südländisch anmutete. Und während Silkes Augen eine undefinierbare, langweilige Farbe irgendwo zwischen Grau und Blau hatten, glühten die von Kristina oft nahezu schwarz.
Auch von ihrer Art her hätten die beiden kaum verschiedener sein können. Kristina war ziemlich selbstbewusst, wenn ihr etwas nicht passte, sagte sie es laut und deutlich. Manchmal wurde sie sogar ziemlich ruppig, fast wie die Mädchen in der Nordstadt. Silke dagegen hatte etwas Heimtückisches, Hinterhältiges an sich. Ihre spitzen Bemerkungen konnten immer so oder so ausgelegt werden. Sie verschoss ihre giftigen Pfeile und versteckte sich schnell wieder hinter Jürgens Rücken.
Aber wenn man genau hinsah, entdeckte man doch viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Schwestern: Sie waren einander fast wie aus dem Gesicht geschnitten, und trotz ihrer üppigen Staturen bewegten sie sich beide ähnlich weich, fast geziert.
Maren blieb mir so fremd wie am ersten Tag. Bei ihr lag es vor allem daran, dass sie kaum den Mund aufmachte, nur still vor sich hinlächelte. Vielleicht dachte sie sich ja ihren Teil, keine Ahnung. Ich jedenfalls konnte in ihr nichts anderes sehen als ein schüchternes, zurückgebliebenes Landei. In der Nordstadt wäre sie total abgemeldet gewesen.
Oft gingen wir ins „Dorf“. So wurde der Kern von Schönhagen genannt, der deutlich älter war als die umliegenden Wohnsiedlungen. Die Häuser strahlten dort etwas Ursprüngliches, fast Gemütliches aus, viele Dächer waren mit Reet gedeckt. Die Straßen hießen „Lütt Dörp“, „Papenwisch“ oder „Twiete“. Eine Gasse, der „Knüll“, war so eng, dass kaum zwei Leute aneinander vorbeikamen. Für Autos war das Dorf gesperrt. Und gerade wurde überall die Teerdecke durch altmodisches Kopfsteinpflaster ersetzt, damit endgültig alles wieder aussah wie früher.
In der Dorfmitte liefen mehrere Straßen und Gassen zur „Grünen Insel“ zusammen, einer mit Bäumen bewachsenen Wiese. Am Rand waren Bänke aufgestellt, von denen aus man über den Mühlenteich blickte. Er war bereits jetzt, im April, arg mit Seerosen zugewachsen. Ein Spazierweg führte einmal ganz um ihn herum. Auf der anderen Seite sah man eine Holzbrücke aus dem Schilf ragen, dahinter lag die historische Wassermühle. Das große Mühlrad drehte sich allerdings nicht mehr.
Die Eisdiele, von der ich die anderen schon so oft hatte reden hören, befand sich ebenfalls an der Grünen Insel. Sie war so etwas wie der Treffpunkt des Dorfes, vor allem abends gab es hier großes „Hallo“ und „Wie geht’s“. Man holte sich Eis, setzte sich auf eine der Bänke oder an die niedrige Ufermauer und ließ es sich schmecken.
Jeder schien hier jeden zu kennen. Ich selbst hatte immer das Gefühl, von allen Seiten misstrauisch beäugt zu werden. An den Klamotten konnte es nicht liegen. Meine ausgefranste Wrangler-Jacke ließ ich jetzt lieber im Schrank, rannte stattdessen mit einer neuen, sauberen Jeansjacke und ebenso properen Hosen herum. Vielleicht waren es die langen Haare? Dann hätte Bernd erst recht auffallen müssen, vom dreckigen Michael ganz zu schweigen. Auf Dauer nervte das permanente Geglotze, aber was sollte ich machen?
Micha wohnte in einem der fetten Kästen am Ende unserer Straße, von denen ich anfangs gedacht hatte, sie würden leerstehen. Seine Alten hatten anscheinend richtig Kohle, gleichzeitig waren sie völlig durchgeknallt. Micha durfte sie anbrüllen, wie er Lust hatte, nannte sie „Arschlöcher“, „Schweine“, „Wichser“ und ähnliches. In der Nordstadt wäre er dafür grün und blau geprügelt worden.
Und er bekam alles, wirklich alles in den Arsch geschoben. „Ey Papa, ich will ’n Schlagzeug“, brauchte er bloß zu sagen, und schon stand da die fetteste Schießbude. „Ey Papa, ich brauch ’n Mischpult“ genügte, und ihm wurde prompt das absolute Profi-Mischpult herbeigezaubert.
Sein Zimmer war im Keller. Er benutzte es gleichzeitig als Übungsraum. Alex sägte auf der Gitarre herum, Micha schwang die Sticks. Es klang alles ziemlich stümperhaft, was die beiden da produzierten, und es war vor allem eines: laut. So laut, dass seine Eltern, die eine Etage höher in ihrer Halle von Wohnzimmer saßen, wahrscheinlich ihr eigenes Wort nicht verstanden. Trotzdem ließen sie den Lärm klaglos über sich ergehen, taten keinen Muckser. Ob sie sich nicht trauten, etwas zu sagen, oder ob ihnen alles egal war, hatte ich noch nicht herausgefunden. Jedenfalls wunderte es mich bei diesen komischen Eltern nicht mehr, dass Micha immer so dreckverkrustet rumlief.
Sein neuestes Steckenpferd war eine Super8-Projektionsanlage, mit der er seinen Keller zum Kino machen konnte. Den Ton ließ er in Dolby-Stereo über den Verstärker laufen. Jeder Streifen kostete mal eben einen Tausender, und er hatte bereits ein ganzes Regal voll davon – wirklich unglaublich!
Ich besuchte ihn manchmal in seinem Keller, wenn er und Alex am Üben waren. Lauschte ihrem Geplärre und Gelärme und baute uns derweil einen Joint. Micha hatte immer irgendwo Dope rumliegen. Wenn die beiden fertig waren, zogen wir das Teil gemeinsam durch.
Einmal kam noch jemand dazu, Schohl. So einen wie den hatte ich noch nie erlebt. Er war unheimlich, irgendwie psycho. Dem traute ich alles zu. Wenn jemand mir erzählt hätte, dass der Typ ab und zu Leuten die Kehle aufschlitzte, einfach weil’s ihm Bock brachte, hätte ich das sofort geglaubt.
Dieser Schohl kramte einen Riegel Pillen aus der Jackentasche, schmiss sie in die Mitte und meinte, die seien total geil. Alex und Micha drückten sich sofort welche aus der Packung und warfen sie ein. Ich zögerte, hatte plötzlich Muffe. Alk und Joints kannte ich, aber diese Dinger? Was machten die mit einem? Schließlich lehnte ich ab, mit irgendeiner billigen Ausrede, und erntete prompt von allen Seiten verächtliche, fast bemitleidende Blicke. Mit einem Schlag waren die Rollen komplett vertauscht: Ich, der Großstädter, sah vor diesen Landeiern ganz klein aus. Und genauso fühlte mich auch.
Plötzlich hatte ich es sehr eilig, aus Michas Keller herauszukommen.
***
Hartmann war am Telefon. Über eine Woche war es inzwischen her, da wir zuletzt gequatscht hatten. Ich berichtete ihm von den neuesten Ereignissen.
„Mensch Hauke!“, rief er, als ich fertig war. „Sieh bloß zu, dass du da schnell wegkommst! Such dir Arbeit, mach ’ne Lehre, was auch immer. Verdien Geld und nimm dir hier ’ne günstige Bude. Da draußen wirst du bekloppt, Mann!“
Mit einem Schlag wurde mir klar, wie abgefahren meine Story für jemanden klingen musste, der warm und trocken in der Nordstadt saß. Dabei hatte ich schon eine entschärfte Fassung geliefert. In der zum Beispiel Jürgens rote Lampe fehlte, ebenso sein Tick mit den Uniformen.
Nach dem Auflegen wurde mir unversehens mulmig. Verdammt, was war jetzt los? So lange hatte ich mich darauf gefreut, wieder in die Nordstadt zu fahren, und nun, da es endlich losgehen sollte, bekam ich plötzlich Schiss!
Ich versuchte mir Mut zu machen. Endlich wieder mit den Kumpels labern, wie ich es gewohnt war, sagte ich mir, ohne Missverständnisse und Peinlichkeiten. Wieder richtige Mädels treffen, nicht solche Dorftussen wie hier. Durch die altbekannten Straßen laufen. Aber es half nicht viel.
Zu allem Unglück hatte Klaus gestern im Suff seinen Wagen gegen die Leitplanke gesetzt – Totalschaden. Jetzt durfte ich mit dem Bus fahren. Drei Stunden Gezockel über die Dörfer – es war wirklich zum Verzweifeln!
***
Am Mittwoch vor Ostern war es auf einmal wieder saukalt und bewölkt. Das gute Wetter hatte genau eine Woche gedauert.
Als ich vormittags zum Treffpunkt an der Straßenecke kam, waren alle schon dort versammelt: Maren, Bernd, Kristina, Jürgen und Silke. Die Mädchen planten einen Besuch auf diesem Öko-Bauernhof, von dem sie mal gequatscht hatten. Und sie wollten ernsthaft zu Fuß latschen, quer durch die Walachei! Mir blieb vor Schreck glatt die Spucke weg.
„Fünf Kilometer sind doch wohl nicht weit!“, ätzte Silke, als ich protestierte, und zog verächtlich eine Augenbraue hoch. Natürlich, sie mal wieder! Inzwischen war ich mir fast sicher, dass sie mich nicht leiden konnte. Aber so viel war klar: Das beruhte auf Gegenseitigkeit!
Die anderen gingen sich „umziehen“, wie sie meinten. Als sie zurückkamen, hatten sie Bundeswehrparkas, Arbeitshosen und ähnliches an. Aber das Beste war: Alle trugen Gummistiefel! Jürgen riet mir, ebenfalls welche anzuziehen. Er hätte zu Hause noch ein altes Paar rumliegen, die könne ich haben, meinte er allen Ernstes. Ich lehnte dankend ab. Gummistiefel – so was kam mir nicht an die Füße!
Draußen in den Feldern musste ich einsehen, dass das ein Fehler gewesen war. Der Weg war total aufgeweicht, an manchen Stellen versackte man regelrecht. Meine Turnschuhe standen bald vor Dreck und Schmodder. Und andauernd fuhren Trecker vorbei, die noch mehr Matsch von den Feldern mitbrachten.
Als wir in einen Wald kamen, wurde der Weg sauberer. Ich wischte mir den Matsch von den Schuhen, so gut es ging. Aber die Erleichterung währte bloß kurz: Der Wald war kleiner als erhofft, und dahinter fing das Elend schnell von vorn an. Zum Glück hatten wir nicht mehr weit zu laufen, bis wir zum Gut kamen.
Schon nach fünf Minuten wusste ich, dass dies der letzte Ort war, an dem ich sein wollte. Überall wieselten Ökos rum, in Felljacken, manchmal mit Stirnbändern, wie Jimi Hendrix. Solche Typen hasste ich inbrünstig. Schwebten mindestens zehn Zentimeter über dem Boden, glaubten, sie hätten den totalen Durchblick. Und wer anderer Meinung war als sie, wurde sofort als Nazi abgestempelt.
Immer wieder kamen riesige Hunde angerannt, die laut kläfften und einen beschnüffelten. Niemand sonst hatte Angst vor den Bestien, die Leute aus der Clique kannten ihre Namen, streichelten sie sogar. Einige der Körnerfresser begannen, mit Jürgen Termine der Freiwilligen Feuerwehr abzustimmen. Ich kapierte die Welt nicht mehr: Waren die dort ebenfalls Mitglieder? Dann hörte ich, wie Bernd mit einem langmähnigen Jesustypen im Blaumann fachsimpelte, es ging um irgendwelche Traktoren, die sie fürs Gut anschaffen wollten. Die Mädchen erkundigten sich bei einem Oberguru mit Glatze und Rauschebart, ob die Lämmer schon geboren waren. ‘Lämmer’?, dachte ich, haben sie wirklich gerade ‘Lämmer’ gesagt?
„Lasst uns mal einen Rundgang machen“, schlug Kristina vor. „Hauke kennt das hier ja alles noch gar nicht.“
Super, antwortete ich in Gedanken, einen Bauernhof wollte ich schon immer besichtigen!
Der Guru schaute an mir herab: „Am besten, du ziehst dir Gummistiefel an.“
Ich war drauf und dran, dem Arschloch eine zu semmeln. Das einzige, was mich zurückhielt, waren die Riesenköter. Die flößten mir einen Heidenrespekt ein.





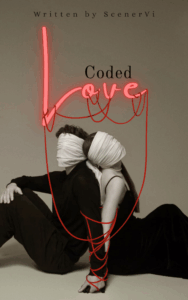





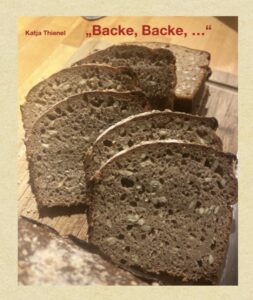






















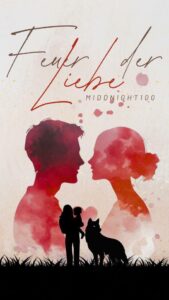

Kommentare